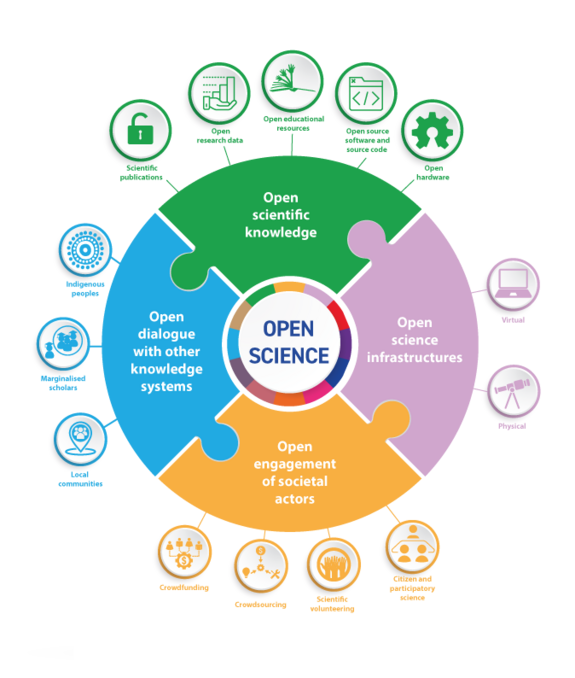Die TU Wien Bibliothek lädt Sie herzlich zum ersten Open Science Day an der TU Wien ein - einer Veranstaltung von und für Forschende.
Organisiert von der TU Wien Bibliothek mit Unterstützung des Vizerektors für Digitalisierung und Infrastruktur bietet dieses Event eine Plattform zum Austausch, Lernen und Vernetzen - ob Sie Open Access publizieren, Forschungsdaten managen, mit Open Source Code arbeiten oder sich in Citizen Science engagieren.
Wann und wo?
Datum: Dienstag, 3. Juni 2025
Uhrzeit: 08:45–17:00 Uhr
Ort: TU Wien Bibliothek, 5. Stock, Vortragsraum
Sprache: Deutsch, Englisch
Warum teilnehmen?
- Erfahren Sie, wie Open Science an der TU Wien gestaltet wird.
- Entdecken Sie Best-Practice-Beispiele von Kolleg_innen.
- Lernen Sie Services und Tools zur Unterstützung Ihrer Forschung kennen.
- Sprechen Sie offen über Herausforderungen und Bedarfe.
- Vernetzen Sie sich in informellem Rahmen mit anderen Forschenden.
Zur Anmeldung
Fragen? Kontaktieren Sie uns unter sekretariat@tuwien.ac.at.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Programm
08:45–09:00 | Willkommenskaffee
09:00–09:15 | Eröffnung durch Bibliotheksdirektorin Beate Guba und Überblick durch Moderator Philipp Steger
09:15–10:30 | Session I:Participatory Research – Good Practices & Challenges
- “Citizen science and urban transformation” – Christian Peer (future.lab Research Center)
- “Citizen Science data supported forest monitoring: Potential, Challenges, and Limitations” – Markus Hollaus (Department of Geodesy and Geoinformation)
- “Soil Walks: How Numbers and Data can raise Awareness for Soil Protection” – Elias Grinzinger, Barbara Steinbrunner (Institute of Spatial Planning)
10:30–11:00 | Diskussionsrunde
11:00–12:30 | Session II: Research Practices From Open Access to AI
- “Community led publishing: Opportunities, challenges and pitfalls using the example of Quantum” – Marcus Huber (Faculty of Physics)
- “Automated Reasoning” – Laura Kovacs (Faculty of Informatics)
- “Open Science in Industry Collaborations: Challenges in Recommender Systems and Behavioral Data Analysis” – Julia Neidhardt (Faculty of Informatics)
12:30–13:00 | Diskussionsrunde
13:00–14:00 | Mittagessen & Networking
14:00–14:20 | Pitch Session: Services for Open Science @ TU Wien
- Citizen Science, Open Access Publishing, Journal Hosting, Recognising Predatory Publishing, PID-Services, Davis as an Open Infrastructure, Text- and Data Mining, TU Wien Academic Press, TU Wien Research Data Repository
14:30–15:30 | Session III: The European Open Science Cloud (EOSC)
- “Short introduction to the EOSC” – Beate Guba (TU Wien Bibliothek)
- “Data Quality Framework for EOSC” – Chris Schubert (TU Wien Bibliothek)
- “Different shades of FAIR" – Tomasz Miksa (Center for Research Data Management)
15:30 | Abschlussworte
Anschließend | Networking und finger food
Vortragende und Abstracts
Elias Grinzinger, Barbara Steinbrunner
Titel: Soil Walks: How Numbers and Data can raise Awareness for Soil Protection
Abstract:
Im Forschungsprojekt "Soil Walks", welches unter der Leitung der TU Wien (Institut für Raumplanung) mit dem Umweltbundesamt und Wallenberger & Linhard Regionalberatung KG durchgeführt wird, wird die gleichnamige Methode des Walk & Talk-Formats zu einer nachhaltigen und breitenwirksamen Bewusstseinsbildung für die Themen Flächeninanspruchnahme, Versiegelung und Innenentwicklung entwickelt. Dadurch soll ein Anstoß des öffentlichen Dialogs und zur Vorbereitung partizipativer Planungsprozesse erreicht werden. Die Methode wird in Form eines Handbuchs und eines Schulungsvideos aufbereitet, damit bewusstseinsbildende Spaziergänge in allen österreichischen Gemeinden und Regionen selbstorganisiert stattfinden können. Unterstützend dazu wurde ein Datendashboard zur Visualisierung von Kennzahlen zu Flächeninanspruchnahme und Versiegelung für ganz Österreichs entwickelt.
Kurzbiografie:
Elias Grinzinger arbeitet und forscht in den Bereichen Ortskernstärkung, Leerstandsaktivierung, Energie- und Mobilitätswende, Bewusstseinsbildung und Digitale Tools am Forschungsbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung (Institut für Raumplanung). Neben der Leitung des Projekts Soil Walks hat er unter anderem das Handbuch Leerstand mit Aussicht mitverfasst und ist Co-Koordinator des Mobilitätslabors land.mobil:LAB.
Barbara Steinbrunner ist Forscherin und Lehrende am Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement (Institut für Raumplanung) und Mitarbeiterin im Projekt Soil Walks. Sie ist außerdem in der örtlichen Raumplanung tätig, als auch Mitglied der Scientist for Future. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Bodenpolitik und Flächensparen, sowie Themen des ländlichen Raumes.
Markus Hollaus
Titel: Citizen Science data supported forest monitoring: Potential, Challenges, and Limitations
Abstract:
Die Einbindung von Bürger_innen in wissenschaftliche Studien klingt vielversprechend und birgt großes Potenzial – nicht nur für die Datenerhebung, sondern auch zur Sensibilisierung der Bevölkerung für bestimmte Themen wie Bäume, Wälder oder Wissenschaft im Allgemeinen. Dies kann zu einer höheren Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Bevölkerung und zu einem gesteigerten Interesse an den untersuchten Themen führen. In diesem Vortrag werden zwei Citizen-Science-Projekte vorgestellt, die derzeit an der Forschungsgruppe Photogrammetrie am Department für Geodäsie und Geoinformation der TU Wien durchgeführt werden. Neben einer allgemeinen Projektvorstellung und der Rolle der Bürger:innen wird auch auf die Potenziale, Herausforderungen und Grenzen im Zusammenhang mit Citizen-Science-Daten eingegangen.
Kurzbiografie:
Markus Hollaus hat 2000 ein Diplomstudium in Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der BOKU Wien abgeschlossen und 2006 an der TU Wien im Bereich LiDAR-Anwendungen für die Forstwirtschaft promoviert. Er ist ein Pionier in der forstlichen Inventur mittels Laserscanning und verfügt über langjährige Erfahrung in der Verarbeitung verschiedenster LiDAR-Daten und deren Auswertung für topografische und forstliche Fragestellungen aus Fernerkundungsdaten.
Marcus Huber
Titel: Community led publishing: Opportunities, challenges and pitfalls using the example of Quantum
Abstract:
Das überwiegend profitorientierte Publikationsmodell kann durch community-geführte Initiativen in Frage gestellt werden, um sowohl verzerrte Anreizstrukturen und bibliometrische Auswirkungen auf die wissenschaftliche Entwicklung als auch die Umleitung öffentlicher Gelder in private Hände zu adressieren. Solche Initiativen bringen jedoch auch generelle Herausforderungen mit sich, die am Beispiel der Publikationsinitiative Quantum illustriert werden. Gegründet im Jahr 2016 auf Basis eines gemeinnützigen Vereins in Wien, ist Quantum heute das weltweit führende Journal im Bereich Quantenberechnung und Quanteninformation. Der Vortrag beschreibt die Geschichte der Zeitschrift, die bewältigten Herausforderungen und zukünftige Perspektiven.
Kurzbiografie:
Marcus Huber ist Physiker und arbeitet an der Schnittstelle zwischen theoretischer und experimenteller Quantenphysik. Nach seiner Promotion an der Universität Wien im Jahr 2010 hatte er Postdoc-Positionen in Wien, Bristol, Barcelona und Genf inne. 2016 kehrte er mit einem START-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nach Wien zurück. Seit 2021 ist er Professor am Atominstitut der TU Wien.
Laura Kovacs
Titel: Automated Reasoning
Abstract:
Zertifizierte Computersysteme werden zunehmend zum Schlüssel für die immer komplexeren Entscheidungsprozesse in unserer modernen Gesellschaft. Fehlerfreie und sichere Lösungen sind unter anderem in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz (KI), autonomen Systemen, Big Data, Blockchain, Dezentraler Finanzen (DeFi) oder Cloud Computing unverzichtbar. Während die explosionsartige Zunahme an Anwendungen von Computersystemen zu enormen Steigerungen von Produktivität, Wohlstand und Komfort führt, entsteht eine paradoxe Situation: Wir verlassen uns auf Computersysteme, obwohl unzählige Szenarien zeigen, dass diese Systeme nicht (ausreichend) zertifiziert sind und daher fehleranfällig sein können.
Das Gebiet des Automated Reasoning bietet computergestützte Lösungen, um zu beweisen, dass Computersysteme fehlerfrei sind – ähnlich wie man mathematische Theoreme beweist. Doch wer sagt Softwareentwickler:innen, welche automatisierten Beweismethoden eingesetzt werden sollten? Und welche Methode eignet sich am besten für Code Reviews, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines Systems zu gewährleisten?
Dieser Vortrag beleuchtet einige Herausforderungen des automatisierten Schließens und konzentriert sich auf konkrete Anwendungsbeispiele der Systemverifikation. Dabei werden Aspekte der Open-Source-Softwareentwicklung hervorgehoben, die es ermöglichen, unsere Lösungen unkompliziert in andere Technologien zu integrieren – ohne dass Nutzer:innen selbst Expert:innen im Bereich des automatisierten Schließens sein müssen.
Kurzbiografie:
Laura Kovacs ist Professorin an der Fakultät für Informatik und Leiterin der Forschungsgruppe „Formal Methods in Systems Engineering “. Sie entwickelt neue computergestützte Methoden zur Programmanalyse und -verifikation, indem sie automatisches Theorembeweisen, automatisierte Generierung von Zusicherungen (Assertions) und symbolisches Rechnen kombiniert. Sie wurde mit einem ERC Starting Grant, einem ERC Proof of Concept Grant und dem ERC Consolidator Grant 2020 ausgezeichnet.
Tomasz Miksa
Titel: Different shades of FAIR
Abstract:
Tomasz Miksa wird veranschaulichen, wie jeder der FAIR-Prinzipien in der Praxis angewendet wird und dabei sowohl die Entscheidungen hervorheben, die Forschende individuell treffen müssen, als auch jene, die von ihren wissenschaftlichen Gemeinschaften geprägt werden. Dies wird sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen von FAIR-Tests beleuchten sowie unsere Bemühungen, FAIR-Tests in die Planung des Datenmanagements zu integrieren.
Kurzbiografie:
Tomasz Miksa ist Senior Researcher mit Spezialisierung auf Datenmanagement, digitale Langzeitarchivierung und Reproduzierbarkeit. Er promovierte an der TU Wien und leitete internationale Projekte in den Bereichen Dateninfrastrukturen, Nachvollziehbarkeit und Open Access. Er ist Vorsitzender der RDA-Arbeitsgruppe für Datenmanagementpläne (DMP) und treibt in Österreich die Entwicklung maschinenlesbarer Datenmanagementpläne voran.
Julia Neidhardt
Titel: Open Science in Industry Collaborations: Challenges in Recommender Systems and Behavioral Data Analysis
Abstract:
Open Science fördert Transparenz und Reproduzierbarkeit, doch ihre Anwendung in Kooperationen mit der Industrie bringt spezifische Herausforderungen mit sich. In Bereichen wie Empfehlungssystemen und der Analyse von Nutzerverhalten entstehen Spannungen zwischen wissenschaftlichen Zielen und geschäftlichen Interessen. Dieser Vortrag beleuchtet zentrale Themen wie eingeschränkten Datenzugang, Publikationsbeschränkungen und proprietäre Modelle. Es werden praktische Erfahrungen und Ansätze vorgestellt, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können, ohne die wissenschaftliche Qualität zu beeinträchtigen.
Kurzbiografie:
Julia Neidhardt ist Assistenzprofessorin an der Forschungsgruppe Data Science an der Fakultät für Informatik der TU Wien mit einem Hintergrund in Mathematik und Informatik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Nutzermodellierung, Empfehlungssystemen, Analyse von Online-Verhalten und digitalem Humanismus. Sie leitet das Christian Doppler Labor für Empfehlungssysteme und hatte Gastaufenthalte an Institutionen wie der Northwestern University und der Universität Genf. Seit 2023 ist sie UNESCO Co-Vorsitzende für Digitalen Humanismus.
Christian Peer
Titel: Citizen science and urban transformation
Abstract:
Citizen Science (CS) befindet sich im Kontext der offenen Wissenschaft und wird als ein Ansatz für partizipative Forschung präsentiert, der potenziell soziale, menschliche, natürliche und technische Wissenschaften miteinander kombiniert. Der Vortrag behandelt CS als eine partizipative Praxis der interdisziplinären und transdisziplinären Wissensproduktion sowie deren methodologisches Potenzial und Herausforderungen in der Stadtforschung. In Bezug auf die Schnittstellen zwischen Technologie und Gesellschaft werden aktuelle Forschungsprojekte, Expert*innendebatten und insbesondere das Forschungs- und Innovationsökosystem angesprochen.
Kurzbiografie:
Christian Peer ist Senior Scientist und leitet das Zentrum für urbane Transformation und den Cluster für soziale Innovation am future.lab der TU Wien. Nach dem Studium der Umweltplanung und der Kultur- und Sozialanthropologie in Graz, Wien und Lyon promovierte er während seiner Tätigkeit bei der Stadtplanungsabteilung der Stadt Wien und trat 2013 der TU Wien bei. Seine Arbeit konzentriert sich auf angewandte Forschung in den Bereichen Architektur und Raumplanung, insbesondere auf Inter- und Transdisziplinarität, Stadtforschung sowie Wissenschafts- und Technikforschung.
Chris Schubert
Titel: Data Quality Framework for EOSC
Abstract:
Explizite Informationen zur Datenqualität entlang der Datenwertschöpfungskette gewinnen zunehmend an Bedeutung – insbesondere im Rahmen der EOSC-Strategieentwicklung. Die ehemalige EOSC Task Force „FAIR Metrics & Data Quality“ hat ein Rahmenpapier mit Empfehlungen zur Datenqualität verfasst – als Chance, nicht als Belastung. Ziel ist die Wiederverwendung vertrauenswürdiger Daten und Methoden, etwa für KI-Anwendungen, sowie die Bereitstellung gemeinsamer Standards für europäische Datenräume. Über offene Konsultationen wurde ein Konsens zur Bereitstellung von Datenqualitätsindikatoren als FAIR-Artefakte erreicht. Die neuen strategischen Säulen der EOSC für 2026–2027 unterstreichen die Relevanz der Datenqualität für Forschungsinfrastrukturen. Ein übergreifender Bewertungsdienst existiert bislang nicht – Beispiele aus NFDI, CODATA sowie aus dem Kultur-, Raumdaten- und Gesundheitsbereich bieten domänenspezifische Einblicke.
Kurzbiografie:
Chris Schubert ist Leiter des Bereichs Medienmanagement und Bibliotheks-IT an der TU Wien Bibliothek. Er arbeitet seit fast 20 Jahren im Bereich der Dateninteroperabilität und Semantik. Er war maßgeblich an der EU-INSPIRE-Richtlinie der Europäischen Kommission beteiligt, insbesondere in den Bereichen Datenmodellierung und EU-Vokabularverwaltung, und ist seit 2015 in den Aufbau einer Klimadaten-Forschungsinfrastruktur in Österreich involviert.