Spannendes aus dem Archiv
Erlesenes
Das Archiv dokumentiert die Geschichte der TU Wien anhand ausgewählter Stücke aus den Beständen.
Texte aus der Zeitschrift TUW Magazine
Die folgenden Artikel erschienen ursprünglich in der Zeitschrift TUW Magazine, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster.
Paulus Ebner leitet seit 2016 das Archiv der TU Wien. Sophie Schimansky hat mit ihm über die ältesten Unterlagen im Archiv, den mühsamen Prozess des Digitalisierens und Forschung und Studieren im Wandel der Zeit gesprochen.
Was sind die ältesten Unterlagen, die Sie archiviert haben?
[PAULUS EBNER]: Grundsätzlich beginnen unsere Dokumente im Jahr 1815, also erst mit der Verwaltung des Hauses. Wir haben alle Studierenden-Akten von 1815 bis 1969 gesammelt, das ist schon sehr spannend. Da sind prominente Leute wie Johann Strauss, Josef Strauss, Christian Doppler oder Viktor Kaplan dabei. Auch Menschen aus der Kulturgeschichte sind da zu finden – Fritz Lang (Regisseur des Kultfilms „Metropolis“, Anm.) hat hier mal kurz studiert; auch prominente Architekten wie Richard Neutra. Und von denen haben wir wirklich die kompletten Unterlagen auf Papier.
Was sind das für Studierenden-Unterlagen?
[P. E.]: Die sind superinteressant, wenn man etwa Familienforschung macht. Da hat man Unterlagen über den Geburtsort, die Zuständigkeit der Familie, die Muttersprache, die Konfession, die Vorbildung und natürlich jede einzelne Lehrveranstaltung, die hier im Haus belegt wurde; ob eine Prüfung abgelegt wurde, welche Note man auf diese Prüfung bekommen hat, et cetera. Man kann auch schauen, ob die später prominenten Architekten gute Noten im Studium hatten. Das sind tolle Unterlagen für die biografische Forschung.
Wie können Studierende dieses Archiv nutzen? Kann jeder darauf zugreifen?
[P. E.]: Wir sind ein öffentlich zugängliches Archiv, das ist ganz entscheidend für uns – das heißt, man muss in keinem Naheverhältnis zur TU Wien stehen. Wir haben allerdings natürlich eher auf Technik fokussiertes Material. Die Studierenden haben jedenfalls immer wieder gemeinsame Lehrveranstaltungen, in denen wir zum Beispiel unsere Nachlässe von Architekten, die mit dem Haus in Verbindung standen, einbringen. Insofern entwickeln wir auch manchmal Lehrveranstaltungen mit Studien wie Kunstgeschichte oder Architekturgeschichte, und das ist eine Win-win-Situation für uns, weil unsere Unterlagen dadurch bekannter werden – und natürlich auch für die Studierenden, da sie mit Originalquellen arbeiten können, was in der digitalen Zeit ja auch nicht so oft vorkommt.
Sie sitzen an der Quelle für Forschungsunterlagen aus mehr als 200 Jahren. Wie hat sich denn Wissenschaft oder der Begriff der Wissenschaft über diesen Zeitraum verändert? Was verstehen wir heute darunter und was war es damals, wenn man jetzt mal bedenkt, dass seit dem Wiener Kongress 1815 einiges passiert ist: Da gab es zwei Weltkriege, die deutsche Revolution und so weiter …
[P. E.]: In den ersten 100 Jahren unserer Unterlagen spielt Forschung keine Rolle. Das kann man ganz klar so sagen. Das ist damals auch keine Hauptaufgabe, sondern die Lehre ist das Wichtige. Vom Niveau her wurde natürlich für die technische Praxis ausgebildet, das war das Ziel; Forschung passierte aber außerhalb der Hochschule. Was aber sehr wohl eine ganz zentrale Aufgabe von Anfang an war: einen Ort für Technologietransfer zu schaffen.
Was heißt das genau?
[P. E.]: Das heißt, dass hier im Haus zum Beispiel alle österreichischen Erfindungen und Patente gesammelt wurden, die im 19. Jahrhundert, also bis 1899, entwickelt worden sind – „österreichisch“ im Sinne der österreichischen Reichshälfte der Doppelmonarchie. Es gab kein Patentamt. Das Patentamt war eigentlich das sogenannte k. k. (kaiserliche und königliche, Anm.) Polytechnische Institut, wie es damals hieß. Und die abgelaufenen Patente, Privilegien hießen sie damals, kamen sofort, nachdem sie abgeschlossen waren, hierher zurück ins Polytechnische Institut. Sie konnten von jedermann eingesehen werden, um die frei gewordenen Erfindungen in die Wirtschaft einzuspielen. Das war eine zentrale Aufgabe, die die Professoren wirklich erfüllen mussten. Sie waren zum Beispiel verpflichtet, diese Patente am Sonntag zu erklären, auch die Funktion von Produkten. Das war damals das Anforderungsprofil für Professoren in diesem Haus.
Was waren das für Patente?
[P. E.]: Eine Schiffsschraube von Josef Ressel aus dem Jahr 1826 zum Beispiel. Auch das Bugholz-Privileg der Familie Thonet ist hier bei uns im Archiv; oder der Klavierbauer Bösendorfer: Dieser besondere Anschlag beim Bösendorfer-Flügel, diese Erfindung mit Zeichnung und allem Drum und Dran, liegt bei uns im Archiv. Jeder, der die frühe Industriegeschichte des 19. Jahrhunderts recherchiert, wird irgendwann einmal auch bei uns landen, wenn ihn die technische Seite interessiert.
Ich stelle mir vor, dass die Unterlagen von vor 200 Jahren einen ganz bestimmten Kreis von Menschen zeigen, wahrscheinlich vor allem Männer aus gewissen Schichten, die studiert und geforscht haben. Wie hat sich das verändert?
[P. E.]: Ja, das ist eine gute Frage. 1815 ist es hier natürlich nur männlich, das muss man dazusagen. Frauen wurden an österreichischen technischen Hochschulen unfassbarerweise erst 1919 zugelassen. Es ist mehr als die Hälfte der Geschichte rein männlich, aber innerhalb der Gruppe ist das Bild extrem divers: Da haben wir Adelige, aber auch Maurer und Handwerker. Wir haben Menschen, die über 40 Jahre alt sind, und auch 14-Jährige. Es war wirklich ein ganz gemischter, noch nicht formalisiert festgelegter Kreis, der hier inskribiert hatte. Viele waren von den Studiengebühren befreit. In den 20er-, 30er-Jahren ist es so, dass die ersten Frauen auftauchen, eher aus dem jüdischen Bereich kommend. Es ist eine ganz, ganz spannende Mischung.
Es gab damals ja keine formale Bedingung. Man musste nur dem Unterricht folgen können und im Idealfall auch die vierte Klasse der Realschule abgeschlossen haben. Wenn das nicht der Fall war, konnte man eine Aufnahmeprüfung machen. Die gesetzlich vorgegebenen Regeln, mit Matura oder Abitur in Deutschland, das hat sich erst später entwickelt – erst in den 60er-, 70er-Jahren. Und dann kippt es auch: In den 60ern kippt dieser völlig freie Zugang in eine völlige Verschulung, also von einem Extrem ins andere, in einen Stundenplan.
Der beginnt am Montagmorgen und endet am Samstag um 12 Uhr. Und dann hat man 60 Stunden Vorlesungen pro Woche gehört – oder so ähnlich. Es gab hier im Jahr 1865/66 noch ein sehr fortschrittlich klingendes Modell, nämlich die Lehr- und Lernzeit. Das heißt, es gab keine Curricula, es gab keine klar strukturierten Studienpläne. Jeder hörte sich an, was er wollte, also wovon er glaubte, dass für ihn wichtig war. Nachteil: Es gab natürlich auch keine Studienabschlüsse im heutigen Sinn. Es gibt prominente Architekten, die bei uns waren, aber formal gesehen müsste man sagen: Diese Person hat zwar bei uns studiert, aber ein Architekturstudium abgeschlossen hat sie eben nicht.
Und jetzt? Heute ist es sehr international. Das war es bis zu einem gewissen Grad immer, aber eher „binnen-international“: Es kamen Studierende aus Galizien sowie den östlichen und nördlichen Gebieten der Monarchie hierher. Und rund um 1900 war ein sehr, sehr großer Anteil auch jüdisch, in manchen Jahren bis zu 30 %.
Mich interessiert natürlich bei solch alten Unterlagen, wie diese digitalisiert werden. MAN kennt ja die Geschichte des Kölner Stadtarchivs, das 2009 einstürzte. Wenn man so spannende, wertvolle Unterlagen in einem Archiv hat, die natürlich durchaus auch anfällig für Zerstörung sind, solange sie nicht digitalisiert sind: Wie geht man damit um? Wie lange dauert das? Wie weit ist man?
[P. E.]: Da wird der Zeitaufwand extrem unterschätzt. Da geht es nicht nur um den Vorgang der Digitalisierung, sondern auch die ganze Logistik dahinter. Man muss das in ein Informationssystem einführen, sich genau überlegen, wie da aus linken und rechten Seiten ein digitales Dokument entsteht. Und wenn es dann zu groß ist, muss man das splitten und anschließend in einem Programm wie Photoshop zusammensetzen. Es gibt sehr, sehr viel zu tun, und das geht alles so viel langsamer, als man denkt! Wir haben aber tolles Equipment bekommen und arbeiten fast ständig daran. Drei Tage in der Woche ist das Gerät eingeschaltet. Es gibt hier aber nur vier Vollzeitstellen. Eine Person ist praktisch immer am Digitalisieren, und trotzdem haben wir noch nicht einmal 0,01 % unseres Bestands digitalisiert. Das wird wohl das nächste Großprojekt werden.
Wir machen aber natürlich auch „Digitalisierung on Demand“: Wenn jetzt zum Beispiel von diesen Privilegien – von diesen Erfindungen, über die wir gesprochen haben – etwas benötigt wird, dann fertigen wir das an und fügen es gleich in unser System ein. Das passiert aber noch nicht systematisch. Die Abgabenordnung schreibt vor, dass ein Papier erst zu uns kommen sollte, wenn es nicht mehr für den täglichen Bedarf benötigt wird, frühestens nach zehn Jahren. Ich schätze mal, die Zeit zwischen 1990 und 2010 wird allein rund 30 % des gesamten Depots fressen! Das ist für uns inzwischen eine Existenzfrage; wir haben Angst, dass wir bald platzen.
Es ist einfach ganz entscheidend, dass die Digitalisierung in einer gezielten und strukturierten Form passiert. Es geht nicht mehr so weiter. Wir können nicht Hunderte Laufmeter von Dekanatsakten, die gesetzlich mindestens 80 Jahre aufgehoben werden müssen, selbstständig digitalisieren, das geht nicht, wir sind ein Miniteam. Und wenn man das nicht machen kann, dann muss es auf Papier bleiben.
Der Bereich Astronomie war in den Programmen des k. k. Polytechnischen Instituts in Wien (PI) zunächst nicht vertreten, aber einige wenige der hier ausgebildeten Alumni waren auf diesem Gebiet aktiv. Christian Doppler (1803–1853), der hier studiert hatte und als Assistent tätig gewesen war, veröffentlichte 1842 als Professor in Prag, wenige Jahre vor seiner Rückkehr an das PI, die Schrift „Über das farbige Licht der Doppelsterne“.
Diese vertrat zwar Hypothesen, die aus astronomischer Sicht nicht haltbar waren, legte aber den Grundstein für die Entdeckung des Dopplereffekts, der später akustisch auch bewiesen werden konnte.
Die erste Vorlesung über „populäre Astronomie“ am PI hielt der Mathematiker und Physiker Leopold Schulz-Straßnitzki (1803–1852) im Studienjahr 1850/51. Mit Schulz-Straßnitzkis frühem Tod verschwand dieses Fach jedoch wieder für einige Zeit aus dem Lehrangebot des Polytechnischen Instituts.
In den für die Entwicklung des PI zur Technischen Hochschule in Wien so entscheidenden Reformjahren um 1865 wurden erstmals detaillierte Curricula entwickelt. Für die sogenannte „Ingenieurschule“, die Bauingenieure ausbilden sollte, waren auch geodätische Fächer von großer Bedeutung: Aus diesem Grund wurde eine Lehrkanzel für „Höhere Geodäsie und sphärische Astronomie“ eingerichtet und 1866 mit Joseph Herr (1819–1884), dem ersten Rektor des PI, besetzt. Seine Lehrveranstaltungen, die unter anderem aus der „Praktischen Uebung im Beobachten“ bestanden, wurden teilweise im 1867 im Hauptgebäude eingerichteten Observatorium abgehalten.
Diese Himmelsbeobachtungsübung war zunächst eine Pflichtveranstaltung in der Ingenieursausbildung, später dann im „geodätischen Kurs“, einem zweijährigen Lehrgang für Geometer. Herr und seine Nachfolger Wilhelm Tinter (1839–1912) und Richard Schumann (1864–1945) publizierten unter anderem zu Themen wie Bahnbestimmung der Planeten und Kometen und führten im Observatorium astronomische Messungen durch. Der Schwerpunkt ihrer publizistischen Aktivitäten und der Lehre lag aber auf dem Gebiet der Nutzung der Erkenntnisse für die Landvermessung, unter anderem mit dem 1928 für die Landestriangulation errichteten 13 Meter hohen Turm auf dem Observatorium.
Aus einer ganz anderen wissenschaftlichen Ecke kam eine Reihe von Forschern, die als Pioniere der Entwicklung des Raketenantriebs, Raketenbaus und der Raumfahrt gelten können. An dieser Stelle können nur zwei von ihnen angeführt werden.
Hermann Potočnik (1892–1929) war Absolvent der Militärakademie und begann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein Elektrotechnikstudium an der TH in Wien, das er 1925 abschloss. Ab 1925 widmete sich der schwer an Tuberkulose erkrankte Potočnik ausschließlich dem Thema Raumfahrttechnik. Unter dem Pseudonym Noordung veröffentlichte er 1928 sein einziges Buch „Das Problem der Befahrung des Weltraums – der Raketenmotor“, das richtungsweisende Vorschläge zur Errichtung von Raumstationen enthält. Das im slowenischen Vitanje 2012 eingerichtete Kulturzentrum für europäische Raumfahrttechnologien ist auch architektonisch seinem Andenken gewidmet.
Eugen Sänger (1905–1964) studierte Bauingenieurwesen, promovierte 1930 in diesem Fach und war bis 1935 als Assistent an der Lehrkanzel für Baustoffkunde und mechanische Technologie an der TH in Wien tätig. Sein richtungsweisendes Buch „Raketen-Flugtechnik“ erschien 1933 und wurde vom Verband der Freunde der Technischen Hochschule in Wien mit der namhaften Spende von 1.000 Schilling gefördert. 1936 wanderte Sänger in das nationalsozialistische Deutschland aus und arbeitete für die militärische Flugzeugindustrie, setzte daneben aber seine Raumfahrtforschung fort. Nach Kriegsende ging er zunächst nach Frankreich, arbeitete aber auch an dem gegen Israel gerichteten Raketenprogramm Ägyptens. Sängers Lebenslauf – er ist nicht untypisch für die Weltraumpioniere aus Österreich und Deutschland dieser Generation – macht klar, warum die TU Wien in diesem Fall keine Ehrungen durchgeführt hat.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
In welchem Alter erreichen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Spitzenpositionen im Universitätsbetrieb? Der Blick in die Geschichte der Vorgängerinstitutionen der heutigen TU Wien zeigt, dass dies in der Frühzeit viel stärker von den Umständen als von der wissenschaftlichen Qualität abhängig war.
Damit soll keineswegs angedeutet werden, dass es den in den 1820er- und 1830er-Jahren berufenen, teils sehr jungen Professoren an Expertise gefehlt hätte, aber die Neuheit der hier angebotenen Fächer und die fehlenden Curricula, die immer auch zu bewältigende Hürden darstellten, erleichterten jungen Assistenten und Praktikern die schnelle Karriere in jungen Jahren.
Die Berufung eines 23-Jährigen zum Professor für „praktische Geometrie und Landvermessung“, wie es Friedrich Anton Gerstner 1819 widerfahren ist, kann heutzutage weitgehend ausgeschlossen werden.
Aus dem Baubereich soll Josef Stummer genannt werden, nicht nur, weil Alexandra Wieser gerade in einer Publikation unseres Archivs die umfangreichen Tagebücher dieses technischen Allrounders vorgestellt hat. Stummer hatte am Polytechnischen Institut und an der Akademie der bildenden Künste studiert. Neben diesen Studien schloss er auch noch eine Maurerlehre ab. Bereits mit 22 Jahren war er in leitender Funktion am Ausbau des Allgemeinen Krankenhauses in Wien (Höfe 8 und 9) tätig, mit 23 war er Assistent am Polytechnischen Institut und mit 28 wurde er zum ordentlichen Professor für Land- und Wasserbau berufen.
Dieses Phänomen der sehr jungen Professoren erfuhr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine jähe Abbremsung und wurde im 20. Jahrhundert weitgehend ins Gegenteil verkehrt.
Was waren die Ursachen? An erster Stelle ist zu erwähnen, dass die zunehmende Formalisierung der Bildung die Blitzkarrieren der Frühzeit unmöglich machte. In den ersten Jahren des Kaiserlich-königlichen Polytechnischen Instituts konnte ein Studium mit etwa 16 begonnen werden, vereinzelt finden sich in den Hauptkatalogen der ersten Jahre auch Studenten, bei denen ein Lebensalter von 15 Jahren eingetragen ist.
Erst mit der großen Studienreform am Polytechnischen Institut, die 1872 auch zur Umbenennung in „Technische Hochschule“ führte, wurde die Matura als Voraussetzung für ein ordentliches Studium auch an Technischen Hochschulen eingeführt und somit ein späterer regulärer Studienbeginn vorgeschrieben.
Die Ausbildung von Curricula mit Mindeststudiendauer führte zu einer Verlängerung der in der Studierendenrolle verbrachten Zeit. Die 1901 geschaffene Möglichkeit, das Doktorat, den Dr. techn., zu erwerben, verschob die Möglichkeiten, eine akademische Karriere zu starten, immer weiter nach hinten – und dazu kam in fast allen an der TH/TU Wien vertretenen Fächern auch noch die für eine Professur unabdingbare Habilitation dazu.
Gab es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine beachtliche Zahl von Professoren, die vor ihrem 30. Geburtstag berufen worden waren, so lässt sich im gesamten 20. Jahrhundert der gegenteilige Effekt beobachten: Von den ersten zehn gewählten Rektoren unserer Universität (1866-1876) hatten nicht weniger als acht zu ihrem 40. Geburtstag bereits den Rang eines ordentlichen Professors erreicht, zwei sogar bereits vor ihrem 30. Geburtstag – 100 Jahre später zeigte sich ein völlig anderes Bild: Von den Rektoren der 1960er-Jahre waren nur zwei bereits mit 40 zum ordentlichen Professor aufgestiegen.
Dazu kommt in der zweiten Hälfte des 19. und auch im 20. Jahrhundert noch der Umstand, dass sich ein professoraler Habitus herausbildete, der einen bürgerlichen Lebensstil und eine gewisse gesellschaftliche Verankerung voraussetzte. Jüngere Habilitierte hatten dies oft noch nicht erreicht – und damit wurde ihnen sehr oft auch die „Professorabilität“ abgesprochen.
Gerade Letzteres hat sich in den letzten 30 Jahren doch sichtbar verändert. Eine dieser Ausnahmen, die ganz gewiss für einen Kulturwandel der TU Wien stehen, war die erste ordentliche Professorin der TU Wien, die 1996 mit 35 Jahren berufen wurde – heute ist Sabine Seidler Rektorin der TU Wien.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Was macht die Exzellenz von Universitäten aus? Glaubt man einschlägigen Rankingsystemen, dann spielen neben vielen anderen Parametern auch Studium, Lehre und Forschung von Nobelpreisträger*innen eine wichtige Rolle. Wie kompliziert diese Geschichte im Fall der TU Wien ist, zeigen die drei folgenden Beispiele.
Philipp Lenard (1862–1947) war – soweit wir das wissen – der erste spätere Nobelpreisträger, der an der TH in Wien studiert hat. Lenard war hier nur ein Jahr, und zwar 1880/81, inskribiert, besuchte viele Vorlesungen und legte auch eine Reihe von Prüfungen ab. Danach unterbrach er sein Studium für einige Jahre und setzte es in Heidelberg fort.
Dass der Name des Nobelpreisträgers für Physik (1905 für Arbeiten zu Kathodenstrahlen) heute keinesfalls für Ehrungen verwendet wird und sich keine der Universitäten, die er in seinem von hoher Mobilität geprägten Studium besucht hatte, seiner rühmt, hat mit Lenards engen und jahrzehntelangen Verbindungen mit dem Nationalsozialismus zu tun. Er war als einer der ersten prominenten Wissenschaftler schon 1923 als Sympathisant Hitlers und der NSDAP aufgetreten. In den Folgejahren etablierte er sich als zentrale Figur der sogenannten „Deutschen Physik“. Diese lehnte Erkenntnisse jüdischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und somit auch moderne Entwicklungen wie Relativitäts- oder Quantentheorie, ab. Dabei argumentierte Lenard auch offen rassistisch.
Der zweite Nobelpreisträger mit Verbindung zur THW hat beinahe sein gesamtes Studium hier absolviert. Richard Zsigmondy (1865–1929) belegte 1883 Technische Chemie und absolvierte im Jahr 1885 die Erste Staatsprüfung in Mindestzeit mit der Bestnote „ausgezeichnet befähigt“.
Er verließ die TH in Wien nach insgesamt vier Studienjahren 1887 in Richtung Göttingen. Der wesentliche Grund: Es war zu dieser Zeit noch unmöglich, an unserer Hochschule ein (für eine wissenschaftliche Karriere in einem naturwissenschaftlichen Fach notwendiges) Doktorat zu erwerben. Die TH Wien erhielt das Promotionsrecht erst 1901.
1889 promovierte Zsigmondy in Göttingen, es folgten Anstellungen als Assistent in München, Berlin und Graz (Habilitation an der TH) sowie ein Intermezzo in der Privatwirtschaft, bevor er 1908 als ordentlicher Professor nach Göttingen zurückkehrte. 1925 erhielt er den Nobelpreis für Chemie für seine Forschungen auf dem Gebiet der Kolloidchemie. Seit 2001 vergibt die Fakultät für Technische Chemie der TU Wien die Richard-Zsigmondy-Medaille.
Ob die TUW in den Rankings vom Nobelpreis für Physik 2022 für Anton Zeilinger profitieren kann, werden wir erst nächstes Jahr erfahren. Er hat zwar nicht an der TU studiert, aber am damals noch gemeinsam mit der Universität betriebenen Atominstitut bei Helmut Rauch (TH/TU Wien) dissertiert und war anschließend lange Zeit an der TUW beschäftigt. 1979 habilitierte Zeilinger sich hier und wurde 1983 zum außerordentlichen Professor ernannt.
Dass auch in Technik- und Wissenschaftssparten, in denen es keine Nobelpreise gibt, eine exzellente Ausbildung geboten wurde (und wird), beweist die Biografie von Heinrich Horner (1910–1994). Horner hatte parallel zu seinem Architekturstudium an der TH auch am Reinhardt-Seminar studiert, war also von Anfang an interdisziplinär orientiert.
Unmittelbar nach seinem Studienabschluss 1933 war Horner als Ausstatter im Theater an der Josefstadt, an der Met in New York und bei den Salzburger Festspielen beschäftigt. Als Jude emigrierte er 1938 endgültig und machte später in Hollywood als Regisseur und Ausstatter Karriere. Seine beiden Oscars für „Best Art Direction – Set Decoration“ in den Jahren 1950 und 1962 werden aber wohl in keinem Ranking Berücksichtigung finden.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TUW Magazine 1/21 - Mobilität
Es ist erstaunlich, dass Literatur und Film das kurze, intensive Leben von Franz Anton von Gerstner bis heute nicht als Vorlage für einen Roman oder eine Serie verwendet haben. Seine Vita enthält viele Facetten, die das beginnende 19. Jahrhundert charakterisieren, und zwar jenseits von Romantik und Biedermeier: Gerstner war Wissenschaftler, Professor, Schriftsteller und Unternehmer in Personalunion. Die Stationen seines Lebens mit den Eckpunkten Prag, Wien, St. Petersburg, New York und Philadelphia bezeugen Gerstners außergewöhnliche Mobilität, die aber auch mit einem Raubbau an der eigenen Gesundheit verbunden war.
In Gerstners Fall waren die Startvoraussetzungen günstig und prägend für seine spätere Karriere: Als Sohn von Franz Josef von Gerstner, Mitbegründer und erster Direktor (1806) des Böhmischen Ständischen Polytechnischen Instituts in Prag, genoss er ebenda eine ausgezeichnete Ausbildung. 1817 übersiedelte er dann nach Wien, aber nicht, um hier weiterzustudieren: Der 21-jährige Gerstner erhielt die Position eines Supplenten (also eines Ersatzvortragenden) für praktische Geometrie und Landvermessung am 1815 neu eingerichteten k. k. Polytechnischen Institut (PI). Sein Vorlesungsskriptum ging bereits im darauffolgenden Jahr in Druck, 1819 wurde er schließlich zum Professor berufen. Er bleibt bis heute der jüngste in dieser Funktion in der Geschichte der TU Wien.
In Wien beschäftigte Gerstner sich nicht nur mit der Lehre, die unter anderem aus aufwendigen geodätischen Übungen in den Wiener Vorstädten bestand: Seine Aktivitäten kreisten sehr bald um das Thema Eisenbahn, die zentrale technische Innovation des beginnenden 19. Jahrhunderts. England war der zentrale Schauplatz dieser ersten Phase der Entwicklung im Schienenverkehr, gerade auch, was den Übergang von Pferde- auf Dampfbetrieb betraf: 1804 konstruierte Richard Trevithick die erste Dampflokomotive, 1825 war die Linie Stockton–Darlington die erste nur mit Dampf betriebene Strecke der Welt.
Dreimal reiste Gerstner in den 1820er-Jahren dorthin, um die neuesten Entwicklungen in Augenschein zu nehmen. 1822 meldete er sich nicht einmal bei der Direktion des PI ab, als er sich in England über die neuesten Innovationen auf dem Eisenbahnsektor informieren wollte – das brachte ihm eine Rüge seitens der Direktion ein, weil der Unterricht ohne Supplierung entfallen war. Doch nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus England reichte Gerstner ein Ansuchen auf ein „Privileg“ (heute Patent genannt) zur Verbesserung der Eisenbahn ein. Der Text dieses Ansuchens stellt ein wesentliches Gründungsdokument des österreichischen Eisenbahnwesens dar und ist auch insofern sehr interessant, weil englische Fachbegriffe wie „locomotive steam engine“, „railway“ oder „conveyance of goods“ in den deutschen Text integriert sind.
1824 erhielt Gerstner endlich das kaiserliche Privileg, die Eisenbahnstrecke zwischen „Mauthausen und Budweis“ zu planen, zu errichten und zu betreiben. Der inzwischen 28-Jährige legte seine Professur am PI zurück, um sich ganz der Praxis zu widmen. Die Bauleitung, das finanzielle Risiko und eine Vielzahl von Problemen führten zu Überarbeitung und ernsthaften gesundheitlichen Problemen. 1829 wurde der Vertrag mit Gerstner gelöst, es gab unter anderem Unstimmigkeiten bei der Trassierung. Die von Gerstner favorisierte spätere Umrüstung von Pferde- auf Dampfbetrieb, die er in England studiert hatte, wurde nämlich ausgeschlossen.
Nach diesem Rückschlag nahm er eine Anstellung in Russland an, wo die erste Eisenbahnstrecke des Landes von Zarskoje Selo nach St. Petersburg nach seinen Plänen entstand (Fertigstellung 1836, durchgehender Dampfbetrieb ab 1838). Doch da war Gerstner im Auftrag des Zarenhofs schon in die USA gereist, um das rasch wachsende amerikanische Eisenbahnnetz zu studieren. In kurzer Zeit bereiste er die Ostküste und den Süden der USA (von Boston bis New Orleans) und starb schließlich knapp nach der Geburt seiner Tochter im April 1840 in Philadelphia.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Texte aus der Zeitschrift TU|frei.haus
Die folgenden Artikel erschienen ursprünglich in der Zeitschrift TU|frei.haus, Online-Magazin für Mitarbeiter_innen der TU Wien.
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 51 / Dezember 2019
Lange bevor eine institutionalisierte technische Ausbildung existierte, gab es immer wieder Frauen, die sich in männerdominierten Bereichen durchsetzen konnten und unbeirrbar ihren Weg gingen – eine von ihnen war die Klavierfabrikantin Nanette Streicher. Aber was hat das mit der TU Wien zu tun …?
Maria Anna, genannt Nanette, wurde am 1. Februar 1769 in Augsburg geboren. Ihr Vater, der berühmte Augsburger Klavierbauer Johann Andreas Stein, der unter anderem Klaviere für Wolfgang Amadeus Mozart baute, unterrichtete sie schon als kleines Kind im Klavierspiel. So spielte sie gemeinsam mit Mozart auch Klavierkonzerte. Doch Stein kümmerte sich nicht nur um die musische Ausbildung seiner Tochter, sondern auch um die handwerkliche. Schon früh erlernte sie den Klavierbau und half in der Werkstatt mit, sodass sie nach dem Tod des Vaters 1792 seinen Betrieb übernehmen und weiterführen konnte.
Zwei Jahre später, 1794, heiratete sie den Musiker Andreas Streicher und zog mit ihm nach Wien. Dort führte sie den Betrieb zunächst gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Matthäus Andreas unter dem Namen „Frère et Soeur Stein d’Augsbourg à Vienne“ weiter. Im Laufe der Jahre kam es jedoch immer wieder zu Streitigkeiten, bis sich die Geschwister beruflich trennten und Nanette die Klavierbauerwerkstatt ab 1802 schließlich allein weiterführte. Ab diesem Zeitpunkt stand auf den Emailleschildern der ausgelieferten Instrumente „Nannette Streicher neé Stein à Vienne“, und ihre Werkstatt wurde zu einem der europaweit bedeutendsten Klavierbauunternehmen.
Der gute Ruf der Streicher’schen Instrumente begründete sich nicht nur auf einer qualitätsvollen Ausführung der Klaviere, sondern auch auf verschiedenen technischen Innovationen. Bereits in Augsburg hatte Nanettes Vater ungewöhnliche Instrumente, wie etwa ein aus einem Hammerklavier und einem darüber montierten Cembalo bestehendes „Poli-Toni-Chlavichordium“ angefertigt. Es ist anzunehmen, dass Nanette diesen „Erfindergeist“ geerbt und in der Wiener Werkstatt weiter an Neuerungen gearbeitet hat. So war die weit verbreitete „Wiener Mechanik“ eine Entwicklung von Nanette und Andreas Streicher, die Adaption einer Prellmechanik, die bereits von ihrem Vater in Augsburg gebaut wurde.
1823 trat der Sohn Johann Baptist in die Firma ein und in den folgenden Jahren entwickelten sie mehrere Erfindungen, die sie auch patentieren ließen. Von den insgesamt fünf Streicher’schen Erfindungsprivilegien (so der damalige Terminus), die sich heute – wie alle Österreichischen Erfindungsprivilegien vor 1850 – im Archiv der TU Wien befinden, wurde Privileg Nr. 2715 vom 14. Juni 1831 von Nanette und ihrem Sohn gemeinsam eingereicht. Es handelte sich um eine Verbesserung der englischen Klaviermechanik, die zwar einen vollen, lauten Klang hervorbrachte, jedoch einiger Kraftanstrengung beim Spielen bedurfte. Klaviere mit Wiener Mechanik waren leichtgängiger zu spielen, jedoch vergleichsweise leiser. Die eingereichte Konstruktion sollte „die leichte brilliante Spielart der Wiener Mechanik mit der Kraft der englischen verein[en]“, so der Kurztext des Patentantrags. Neben einer ausführlichen Beschreibung war dem Privileg auch eine detaillierte Zeichnung beigelegt.
Die Streichers beschäftigten sich aber nicht nur mit dem Klavierbau, sondern gestalteten aktiv das Wiener Musikgeschehen. Sie zählten zu den Mitbegründern der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (heute besser bekannt als Wiener Musikverein) und veranstalteten eigene Konzerte. Diese fanden zunächst in ihren Wohnräumen statt, ab 1812 in einem eigens errichteten „Klaviersalon“ in ihrem Haus in der Ungargasse im dritten Bezirk, wo sich auch die Werkstatt befand. In dem etwa 300 Zuhörer_innen fassenden Saal wurde auch jungen Künstler_innen die Möglichkeit geboten vor einem größeren Publikum aufzutreten. Die Streichers pflegten Kontakte zu international bekannten Musikern, so bestand etwa eine lebenslange Freundschaft mit Ludwig van Beethoven, der auch ein gern gesehener Gast bei den Konzerten war.
Nanette Streicher verstarb am 16. Jänner 1833, ihr Ehemann Andreas nur etwas mehr als vier Monate nach ihr. Ursprünglich wurden beide am St. Marxer Friedhof bestattet. Als dieser 1863 aufgelassen werden musste, bettete man sie auf den Matzleinsdorfer Friedhof um. Ihre tatsächlich letzte Ruhestätte fanden sie im Oktober 1891 gemeinsam mit ihrem Sohn Johann Baptist in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof.
Nanette Streichers beruflicher Werdegang beeindruckt noch heute: Eine Frau, die sich in einem traditionell männerdominierten Handwerk nicht nur zu behaupten wusste, sondern mit ihren Instrumenten zu den besten Klavierkonstrukteur_innen ihrer Zeit zählte.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien
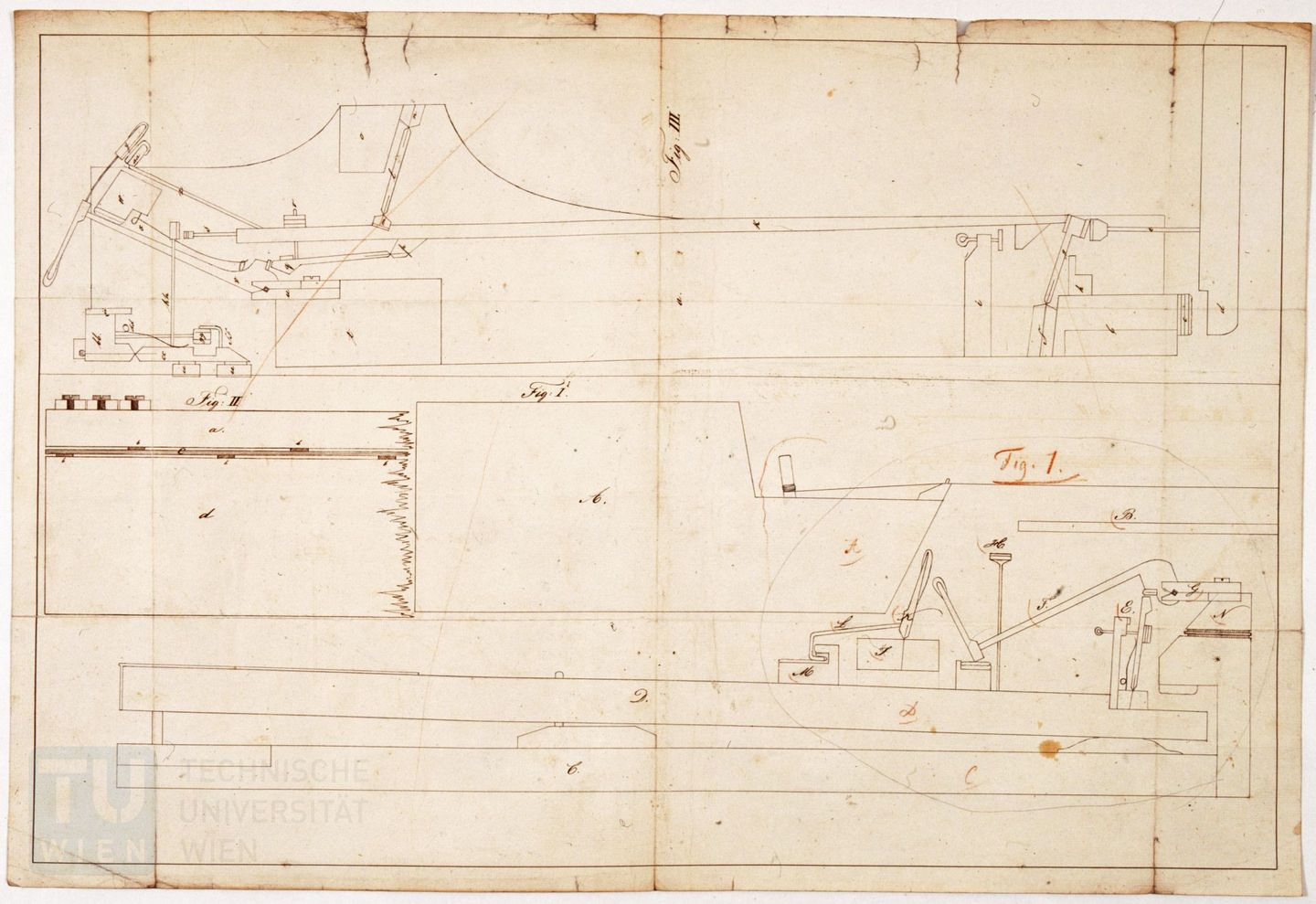
Zeichnung zum Klavierprivileg
Zeichnung zum Privileg Nr. 2715; Foto: (c) Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 51 / Dezember 2019
Zum 100. Geburtstag von Heinz Zemanek
Am 1. Jänner 2020 wäre der österreichische Computerpionier Heinz Zemanek 100 Jahre alt geworden – Grund genug, um an diese faszinierende Persönlichkeit zu erinnern, die auch mit der TU Wien über viele Jahrzehnte als Student, Forscher und Lehrender verbunden war.
Viele werden bei seinem Namen vor allem das „Mailüfterl“ assoziieren, den ersten volltransistorisierten dezimalen Computer auf dem europäischen Kontinent. Er wurde von Zemanek und seinem Team in den 1950er Jahren am Institut für Niederfrequenztechnik/Fernmeldetechnik II der damaligen TH in Wien entwickelt und gebaut. Aber das war nur eine Facette eines Wissenschaftlers, dessen Lebensspanne fast das ganze 20. Jahrhundert über alle historischen Brüche und Umbrüche hinweg umfasste. Denn er hat sich stets nicht nur für fachwissenschaftliche Themen, sondern auch für philosophische, historische, politische, gesellschaftliche, religiöse und musische Fragen interessiert und dazu aktiv Stellung genommen.
Geboren wurde Heinrich Josef Zemanek, so sein vollständiger Name, am 1. Jänner 1920 in Wien. Hier besuchte er die Schule und maturierte 1937 mit Auszeichnung an der Gumpendorfer Realschule (heute BRG 6 Marchettigasse). Hier schloss er sich auch den St. Georgs-Pfadfindern an. Aus dieser Verbindung erwuchsen nicht nur lebenslange Freundschaften. Ihr verdankte er auch die Möglichkeit, früh erste Auslands- und Führungserfahrungen zu sammeln: Schon 1937, mit 17 Jahren, vertrat er Österreich als stellvertretender Delegationsleiter auf einem Jamboree in Vogelenzang/Niederlande.
Im Wintersemester 1937/38 inskribierte er an der damaligen TH in Wien Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Wie bei vielen Angehörigen seiner Generation wurde sein Studium 1940–1945 durch die Einberufung zur Deutschen Wehrmacht unterbrochen. Nach verschiedenen Stationen auf dem Balkan als Nachrichtentechniker und Lehrer in der Armeenachrichtenschule in Saloniki wurde er 1943 in die Rüstungsforschung dienstverpflichtet, zunächst bei der Reichsstelle für Hochfrequenzforschung in Reichenau am Semmering, ab Juli 1944 bei der Zentralversuchsstelle für Hochfrequenzforschung in Ulm-Dornstadt. In dieser Zeit stellte er auch seine Diplomarbeit unter Betreuung von Richard Feldtkeller/Uni Stuttgart fertig und legte während eines Studienurlaubs Ende 1944 in Wien seine II. Staatsprüfung ab.
Nach seiner formellen Entlassung aus der Wehrmacht Ende April 1945 konnte Zemanek im Februar 1946 nach Wien zurückkehren. Dort entschied er sich bald für eine akademische Karriere: Im Juli 1947 begann er als wissenschaftliche Hilfskraft am damaligen Institut für Schwachstromtechnik der TH in Wien, wo er 1951 über „Zeitteilverfahren in der Telegraphie“ promovierte und sich 1959 mit einer Arbeit „Zur Störverminderung imperfekter Schaltnetzwerke“ habilitierte.
In den 1940er Jahren waren Fragen der elektronischen Datenverarbeitung und der Bau von Computern bereits an Universitäten und bei einigen Firmen ein Thema, insbesondere in den USA und in Großbritannien. Auch am Institut in Wien wurden kleinere elektronische Rechenmaschinen und kybernetische Maschinen zu Studienzwecken nachgebaut. Anregungen bot Zemanek ein Studienaufenthalt in Paris 1948/49, wo er Louis Couffignal am Institut Blaise Pascal besuchte, der damals mit dem Bau eines eigenen Computers begann. Spätestens ab 1951 stellte Zemanek selbst erste konkrete Überlegungen zum Bau eines großen Computers an. Den Anstoß für eine praktische Umsetzung gab 1954 die Verleihung des Förderungspreises des Theodor-Körner-Stiftungsfonds in Höhe von beachtlichen ÖS 30.000 an Zemaneks damaligen Vorgesetzten, Prof. Eugen Skudrzyk, mit dem Auftrag, eine große elektronische Rechenmaschine zu bauen. Mit dieser Aufgabe wurde Zemanek betraut. Zwar war die Fördersumme bei weitem nicht ausreichend für ein solches Vorhaben, doch es gelang ihm in der Folge, viele notwendige Bauteile, z. B. Transistoren, als Sachspenden von verschiedenen Firmen zu „erbetteln“ sowie weitere Subventionen und Förderstipendien einzuwerben. Damals begann auch die Zusammenarbeit mit Konrad Zuse und seiner Firma in Deutschland.
Noch wichtiger war, dass es Zemanek gelang, aus interessierten Studenten (es waren wirklich nur Männer) durch Vergabe von Diplomarbeiten zu Teilproblemen ein Team zu bilden – eine Arbeitsform, die damals an Universitäten durchaus noch unüblich war. Dabei konnte er wohl auch von dem Freiraum profitieren, den ihm die Abwesenheit seines Chefs verschaffte: Skudrzyk befand sich ab 1954 zu einem längeren Forschungsaufenthalt in den USA, der 1956 in seine dauerhafte Auswanderung mündete; Zemanek hatte zeitweise die Aufgabe, seine Vorlesungen zu supplieren.
Im Mai 1958 war der Rechner funktionsfähig. Erste Rechenaufträge wurden ausgeführt, u.a. schon 1958 Primzahlberechnungen sowie 1959 die Berechnung von Alltonreihen für den Komponisten Hanns Jelinek. Bald waren die Ambitionen der Gruppe jedoch über den Rahmen, der an einem Hochschulinstitut realisiert werden konnte, hinausgewachsen. Aufgrund der Kontakte, die Zemanek infolge seiner Arbeiten hatte knüpfen können, gelang 1961 der Transfer des gesamten Projekts, einschließlich vieler Mitarbeiter, zur Firma IBM. Dort wurde das „Mailüfterl“ noch einige Jahre genutzt, bis es 1965 endgültig nicht mehr funktionsfähig war. Nach der Ausmusterung des Rechners bei IBM 1966 ging er zunächst an die JKU Linz, ab 1973 an das Technische Museum Wien, wo das „Mailüfterl“ bis heute zu sehen ist.
Für Zemanek begann mit dem Übertritt zu IBM, zunächst als Leiter einer Forschungsgruppe und ab 1964 als Direktor des Wiener Forschungslabors, ein neuer beruflicher Abschnitt. Zu den am Labor durchgeführten Projekten gehörten die Entwicklung des Sprachausgabegeräts Vocoder (für das schon an der TH Wien Vorarbeiten geleistet worden waren), vor allem aber der Einstieg in die Softwareprogrammierung mit der Entwicklung der Programmiersprache PL/I und der „Vienna Definition Language“ (bzw. Method).
Konzerneigene Strategieänderungen bei IBM führten ab Mitte der 1970er Jahre zwar noch nicht zur Auflösung, aber doch zu einer Änderung der Arbeitsaufträge an das Wiener Labor und zur Ablösung von Zemanek als Direktor. Er wurde 1976 zum IBM Fellow ernannt und konnte sich damit einer Forschungsaufgabe eigener Wahl widmen. Er wählte das Thema einer Theorie des Systementwurfs, das er „Abstrakte Architektur“ nannte. Bis zu seiner Pensionierung 1985 verfasste er dazu zahlreiche Beiträge, seine abschließende Darstellung wurde leider niemals publiziert.
Neben seiner Tätigkeit bei IBM hielt Zemanek an der TH/TU Wien seit 1959 als Dozent, seit 1964 als Titularprofessor bis 2007/08 regelmäßig Vorlesungen. Dabei wandte er sich bald von der Nachrichtentechnik ab und Themen der Kybernetik, des Verhältnisses von „Mensch und Computer“, und der Geschichte der Informatik zu; gerade dieses Thema konnte er als jemand, der fast alle Größen der noch jungen Disziplin persönlich gekannt hatte, besonders kompetent und auch unterhaltsam vermitteln. Dazu betreute er zahlreiche Diplomarbeiten und Dissertationen, außerdem war er als Gastvortragender an anderen Universitäten – u. a. an der TU München, der Universität Stuttgart und der Donau-Universität Krems – verpflichtet.
Bedeutend war Zemaneks Wirken als Wissenschaftsorganisator: Er war seit ihrer Gründung 1959 in der International Federation for Information Processing (IFIP) engagiert, 1967/68 als Mitglied des IFIP Council, 1971-1974 als Präsident und nicht zuletzt 1961-1967 als Chair des wichtigen Technical Committee on Programming Languages (TC2). Dabei hat er seit den 1960er Jahren besonders die Kontakte zu den Kollegen in der Sowjetunion und in Osteuropa gepflegt. Daneben wirkte er an der Organisation mehrerer Kongresse und Working Meetings mit, wobei er etwa durch die Initiierung der Kongress-Serie „Human Choice an Computers“ schon in den 1970er Jahren den Fragen der Wechselwirkung von Computer und Gesellschaft eine Diskussionsplattform schuf.
Ebenso war er bei der Gründung der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) 1975 maßgeblich beteiligt, 1975/76 als Gründungspräsident, danach lange als Vorstandsmitglied. In Anerkennung seiner Verdienste stiftete die OCG 1985 den Heinz Zemanek-Preis.
Umfangreich war auch Zemaneks Tätigkeit als Autor und als Herausgeber von Fachzeitschriften (Elektronische Rechenmaschinen/it/itti, Annals of the History of Computing, Abacus) sowie als Herausgeber von Publikationsreihen für IBM, für die IFIP (darunter mehrere Jubiläumspublikationen) und für die OCG.
Aber seine Interessen und seine Schaffenskraft reichten weiter: Besonders die Vor- und Frühgeschichte des Computers und des automatischen Rechnens hat Zemanek sehr früh angezogen. Angeregt durch US-amerikanische Vorbilder, die er auf seinen häufigen Reisen kennen gelernt hatte, versuchte er sich schon 1973 an einer Visualisierung der Geschichte der Informationsverarbeitung. Er konzipierte eine Präsentation, die die verschiedenen Wurzeln der Computer- und Informationstechnik und ihre historischen und philosophischen Hintergründe darstellen sollte, in Form einer „Geschichtswand“. Auch in seinem beruflichen Umfeld setzte er sich für die Bewahrung von Dokumenten und Artefakten zur Geschichte der Informationstechnik ein. Im Rahmen der OCG ging die Gründung der Österreichischen Gesellschaft für Informatik-Geschichte (ÖGIG) 1996 auf seine Initiative zurück. Auch seine Mitwirkung an der Ausstellungskonzeption der Technischen Museen in Wien, München und Paderborn geht auf sein Interesse an der „Computergeschichte“ zurück, wobei er inzwischen bald selbst als Zeitzeuge auftreten konnte.
In seinen eigenen historischen Forschungen zeigte er sich vor allem biographisch interessiert. Den Vorläufern und „Pionieren“ des Computers von Wilhelm Schickhardt über Otto Schaeffler zu Hermann Hollerith widmete er zahlreiche biographisch-historische Studien, ebenso den Vordenkern der mathematischen Grundlagen wie dem arabischen Mathematiker Al-Khorezmi.
Darüber hinaus hat Zemanek sich schon früh für theoretische und philosophische Fragen der sich entwickelnden Informationstechnik und Informatik und verwandter Gebiete, wie Kybernetik, Mathematik, Kalenderwesen interessiert. Intensiv beschäftigt haben ihn insbesondere das Verhältnis von Computer und Kunst, Computer und Sprache (hier vor allem im Zusammenhang mit dem „Wiener Kreis“) sowie generell von Technik- und Naturwissenschaften zu philosophischen und Glaubensfragen. Zu all diesen Aspekten hat er auch publiziert und zahlreiche Vorträge gehalten.
Geistige Anregungen, aber auch Ressourcen für die Verfolgung dieser vielfältigen Interessensgebiete erhielt Zemanek durch sein außerordentlich umfassendes persönliches Netzwerk. Die Mitgliedschaft in zahlreichen wissenschaftlichen Vereinigungen sowie in mehreren Wissenschaftlichen Akademien brachte ihn immer wieder in Kontakt mit anregenden Gesprächspartner_innen: Unter anderem gehörte er seit 1979 der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als korrespondierendes, seit 1984 als wirkliches Mitglied an. Schon seit 1971 war er, aufgrund seiner musikalischen Interessen insbesondere für elektronische Musik, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.
Auch die zahllosen Reisen in alle Welt, die Zemanek in seiner dienstlichen Tätigkeit und als Verbandsfunktionär unternahm, brachten ihm immer wieder neue Anregungen und persönliche Kontakte. Er hat diese aber auch intensiv gepflegt, wie seine außerordentlich umfangreiche Korrespondenz bezeugt, die fast seine gesamte Lebenszeit umfasst. Sie enthält neben privaten Kontakten Schriftwechsel mit Wissenschaftler_innen verschiedenster Disziplinen, insbesondere jenen, die im Bereich der Informatik und Informationstechnik seiner Zeit von Bedeutung waren. Darunter finden sich prominente Namen von Pionieren wie Isaak L. Auerbach, Roberto Busa SJ oder Konrad Zuse und von Wissenschaftlern wie Heinz von Foerster, Benoît Mandelbrot, Carl Menger, Oskar Morgenstern und Joseph Weizenbaum. Darüber hinaus hat Zemanek auch mit zahlreichen Philosoph_innen, Komponist_innen und Künstler_innen korrespondiert, darunter dem Komponisten Gottfried v. Einem, Lotte Ingrisch, dem Pianisten Hans Kann oder der Tänzerin und Kabarettistin Cilli Wang.
Seine Leistungen haben Zemanek eine fast unüberschaubare Anzahl von Ehrungen und Auszeichnungen eingebracht, von denen hier nur einige wenige genannt werden sollen: dazu gehören Ehrenmitgliedschaften in zahlreichen Fachvereinigungen und die Ehrendoktorate der Johannes-Kepler-Universität Linz 1982 sowie der Universität Erlangen-Nürnberg 1986. Die TU Wien hat Zemanek 1978 mit der Verleihung der Prechtl-Medaille geehrt, im Jahr 2000 wurde der Heinz-Zemanek-Saal nach ihm benannt.
Heinz Zemanek verstarb am 16. Juli 2014. Sein umfangreicher Nachlass befindet sich im Archiv der TU Wien, seine wissenschaftliche Büchersammlung wird in der Bibliothek der TU Wien verwahrt.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 50 / Juni 2019
Josef Redlich war nicht nur Jurist, Historiker, Politiker und Mitglied in zahlreichen Kommissionen, er war auch Universitätsprofessor an der Technischen Hochschule Wien. Geboren am 18. Juni 1869 in Göding (heute: Hodonin in Tschechien) besuchte er gemeinsam mit seinem Bruder Fritz das Akademische Gymnasium in Wien. Nach der Matura studierte er Jus an der Wiener Universität, aber auch in Leipzig und Tübingen. 1891 schloss er das Studium ab und erlangte 1901 mit seinem Buch „Die englische Lokalverwaltung“ internationale Beachtung.
Der Experte für Verwaltungsrecht hielt als Privatdozent ab 1901 Vorlesungen an der Universität Wien, 1903 konvertierte er vom jüdischen zum evangelischen Glauben und wurde 1906 zum außerordentlichen Professor ernannt. Redlich beschäftigte sich aber nicht nur theoretisch mit Verwaltungsrecht, er wollte die staatliche Verwaltung auch praktisch mitgestalten. 1906 Mitglied des mährischen Landtags, wurde er 1907 auf der Liste der deutsch-freisinnigen Partei in den österreichischen Reichsrat gewählt. Trotz politischer Verpflichtungen engagierte er sich nach wie vor in der Rechtslehre und erhielt am 1. Oktober 1909 an der TH Wien eine ordentliche Professur für Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Neben diesen beiden Fächern umfasste seine Lehrverpflichtung auch noch öffentliches und privates Versicherungsrecht sowie zeitweise eine Spezialvorlesung über Wasserrecht.
Redlich war bereits während seiner Lehrtätigkeit so gefragt, dass er 1910 an der Havard University und an der State University of Illinois Vorträge über österreichisch-ungarisches Staatsrecht hielt; hierfür ließ er sich von der Hochschule beurlauben. Neben seinen Lehrverpflichtungen in Wien begann er zeitweise auch an den renommierten US-amerikanischen Universitäten Vorlesungen über Verwaltungs- und Verfassungsrecht zu halten und konnte so wichtige Kontakte knüpfen.
Als Rechtsexperte und Politiker mit großem Fachwissen war er international hoch angesehen und genoss auch in Österreich einen guten Ruf, zählten doch Persönlichkeiten wie Arthur Schnitzler, Hermann Bahr oder Hugo von Hofmannsthal zu seinen Freunden und Bekannten. Er versuchte stets, politische Ämter und Lehre in gleichem Maß zu bewältigen. Als ihn jedoch Kaiser Karl I. am 27. Oktober 1918 zum k. k. Finanzminister bestellte, musste er seine Lehrverpflichtung an der TH „mit schwerem Herzen“ beenden. Er hoffte jedoch, „den Interessen der Technischen Hochschule in Wien jederzeit nützlich zu sein“, wie er in seinem Brief an den Rektor Karl Zsigmondy am 29. Oktober 1918 schrieb. Sein neues Amt konnte er allerdings aufgrund der politischen Geschehnisse nicht lange ausführen: Am 3. November 1918 kapitulierte Österreich-Ungarn und am 11. November unterzeichnete der Kaiser seinen Verzicht auf die Staatsgeschäfte.
Mit dem Ende der Monarchie ging auch Redlichs politische Karriere vorerst zu Ende. Seine Expertise wurde zwar sehr geschätzt, er wurde aber immer nur als Berater konsultiert, daher konzentrierte er sich nun auf seine Lehrtätigkeit in Übersee. Er pendelte zwischen Österreich und den USA, hielt zahlreiche Vorträge und unterrichtete ab 1926 als ordentlicher Professor vergleichendes Staats- und Verwaltungsrecht an der Harvard University in Cambridge. Ein letztes Mal kehrte er aufs politische Parkett in Österreich zurück: Im Juni 1931 übernahm Redlich noch einmal das Amt des Finanzministers. Der Zusammenbruch der Creditanstalt löste eine allgemeine Wirtschaftskrise aus und er, der mittlerweile auch Ersatzrichter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag war und das Vertrauen von Bundeskanzler Buresch sowie der westlichen Staaten genoss, sollte den österreichischen Staatshaushalt sanieren. Seine Vorstellung eines Sparpakets stieß jedoch auf massiven Widerstand, weswegen er bereits im Oktober 1931 sein Amt zurücklegte. In seiner kurzen Amtszeit konnte er die Reorganisation der Creditanstalt in wesentlichen Punkten zu Ende führen.
Neben den zahlreichen Rechtstexten sind Redlichs Tagebuchaufzeichnungen, die er von 1909 bis zu seinem Tode 1936 führte, besonders interessant. Er beschreibt darin nicht nur das Auseinanderbrechen des habsburgischen Vielvölkerstaates, sondern gibt auch vielfältige Einblicke in gesellschaftliche Verflechtungen und brisante politische Geschehnisse der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Die dreibändige Edition der Tagebücher ist eine spannende Lektüre und aktueller denn je.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 49 / März 2019
Das Gesetz mit dem ungewöhnlich kurzen und prägnanten Titel „Bundesgesetz vom 10. Juli 1969 über die technischen Studienrichtungen“ (Bundesgesetzblatt 290/1969) bedeutete für die österreichischen Technischen Hochschulen einen Meilenstein.
Im Geiste der gegen Ende der 1960er Jahre auch in Österreich angekommenen Forderung nach Mitbestimmung waren auch die Studierenden an der Abfassung des Gesetzes beteiligt, und zwar durch eine Reihe von Kommentaren zu den Entwürfen. In den Jahrgängen 1968 und 1969 der ÖH-Zeitschrift „Quo vadis“ ist das Thema „Technikstudiengesetz“ absolut dominant.
Was genau ist an diesem Gesetz so wichtig? Am unspektakulärsten, weil nach außen unsichtbar, war die Einführung von Diplomprüfungen anstatt der bisher existierenden Staatsprüfungen. Damit verbunden war nun der Erwerb eines akademischen Titels für die Absolvierung der 2. Diplomprüfung an Technischen Hochschulen. Erstmals an der TH mit Ausnahme der Jahre nach dem „Anschluß“, in denen die reichsdeutschen Hochschulgesetze galten. Bis zu der in diesem Gesetz festgelegten Diplomprüfungsregelung konnten Absolvent_innen der TH nur einen Standestitel erwerben. Da dieser Titel „äußerlich“ unverändert blieb, kam es für Absolvent_innen, die bis dato den gleichnamigen Standestitel erworben hatten, zu keiner Zurücksetzung. Die Akademisierung der Studien stellte jedenfalls einen wesentlichen Schritt zu einer „Technischen Universität“ dar.
Das Gesetz regelte nicht nur den Ablauf des Studiums und die Hauptfächer bei den Ersten und Zweiten Diplomprüfungen, sondern legte auch fest, welche Studienrichtungen und -zweige an Technischen Hochschulen in Österreich angeboten werden mussten. Auf diese Weise war klar, dass möglichst rasch bisher nicht existierende Studienrichtungen wie „Informatik“ und „Raumplanung und Raumordnung“ einzurichten waren.
Die dritte große Änderung, die Einführung von drittelparitätischen Studienkommissionen, war schon im Allgemeinen Hochschulstudiengesetz (AHStG) von 1966 vorgesehen, im Technikstudiengesetz war aber nun erstmals die sofortige (dh. ab dem Wintersemester 1969/70) Einsetzung von Studienkommissionen festgelegt. Diese Studienkommissionen waren zu gleichen Teilen von der Professorenschaft, dem Mittelbau (der von Dozent_innen über Assistent_innen bis zu den Vertragslehrer_innen reichte) und den Studierenden zu besetzen. Eine weitere, für 1969 sicher ungewöhnliche Regelung: Ein geschlossenes Eintreten einer der drei Kurien gegen einen Vorschlag reichte aus, um diesen zu Fall zu bringen. Die wichtigsten Aufgaben der Studienkommissionen waren die Erlassung von Studienplänen, die Abgabe von Empfehlungen zur Gestaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie die Überprüfung von systemischen Gründen für Studienverzögerungen.
In der parlamentarischen Debatte am 10. Juli 1969 waren sich die Vertreter_innen aller Parteien über die Vorzüge des neuen Gesetzes einig. Herta Firnberg von der oppositionellen SPÖ begrüßte die Einführung von Studienkommissionen als wichtigen Schritt zur Demokratisierung der Hochschulen, Otto Scrinzi von der FPÖ sah, bei positiver Gesamtbewertung, die Studienkommissionen mit Skepsis, Josef Gruber von der ÖVP betonte die enge Kooperation von „Lehrenden und Lernenden“ bei der Erstellung des vorliegenden Gesetzes.
Genau diese enge Zusammenarbeit spiegelt sich sowohl in den Zeitschriften der Hochschülerschaft der TH in Wien (HTHW) als auch in den Publikationen der Hochschule. Zwar gab es in Details immer wieder Dissonanzen, aber letztlich waren beide Seiten, Hochschulleitung und HTHW mit dem Resultat sehr zufrieden.
So sehr es sich dabei auch um einen wichtigen Schritt zur Demokratisierung der Hochschulen gehandelt hat, in einem ganz wesentlichen Punkt blieb alles beim Alten: In den im Dezember 1969 und Jänner 1970 konstituierten Studienkommissionen waren (Ersatzmitglieder eingerechnet) ca. 170 Personen aktiv. Darunter war keine einzige Frau…
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Cover Zeitschrift Quo Vadis 1969; Foto: Quelle: Archiv der TU Wien
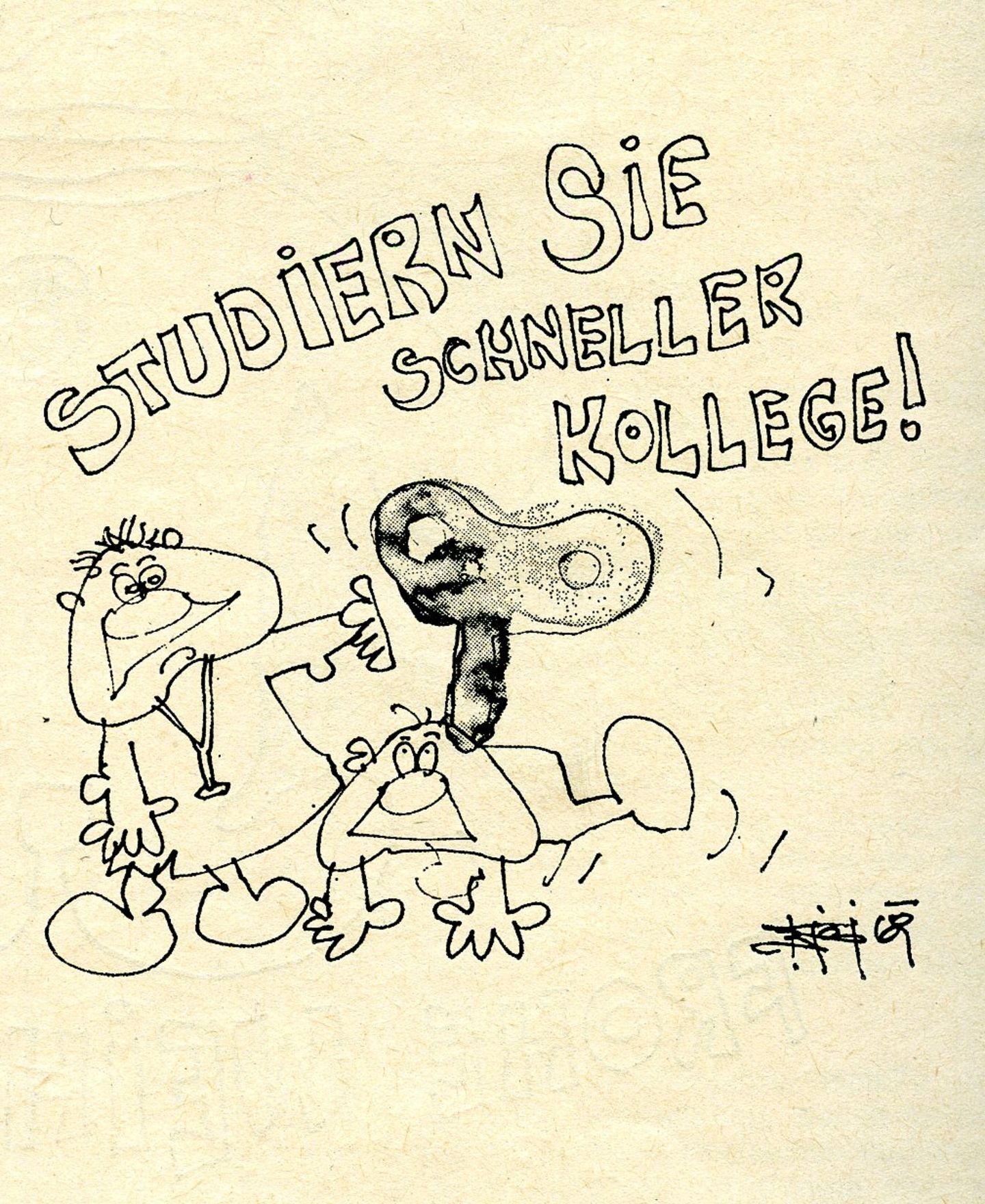
Bildausschnitt Zeitschrift Quo Vadis 1969; Foto: Quelle: Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 48 / Oktober 2018
Im Zweiten Weltkrieg gerieten einige Angehörige und Absolvent_innen der Technischen Hochschule in Wien trotz geglückter Emigration durch das Vordringen der deutschen Armeen in die Fänge der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Als einen von vielen sei hier an den Lebensweg des 1904 in Wien geborenen Friedrich Kraus erinnert.
Kraus‘ Bildungskarriere war durchaus ungewöhnlich: Er war ein Werkstudent im klassischen Sinn. Sein Studium diente der Vertiefung des Wissens auf dem Feld, in dem er beruflich tätig war. 1922 hatte er an der Bundesrealschule Wien XIX maturiert, danach begann er zu arbeiten. 1929 trat er in das „Textiltechnische Büro und Maschinengeschäft Koref“ in der Servitengasse ein, wo sein Vater Leopold als Oberbuchhalter beschäftigt war. Im selben Jahr heiratete er Gisela Bettelheim, die ebenfalls bei Koref arbeitete.
Neben der Arbeit begann Kraus im Wintersemester 1931, also neun Jahre nach seiner Matura, ein Maschinenbaustudium an der TH in Wien, das er in der Mindestzeit von fünf Jahren abschließen konnte. Er legte am 6. Juli 1936 die II. Staatsprüfung ab und war somit berechtigt den Standestitel „Ingenieur“ zu führen.
Im „Büro Koref“ konnte er sein erworbenes Wissen einsetzen und seine textilchemischen Kenntnisse erweitern. Dabei stand ihm seine Frau zur Seite, die zwar keine akademische Ausbildung hatte, aber – folgt man Zeitzeugen – über eine große Expertise über die chemische Zusammensetzung von Stoffen verfügte und eng mit ihrem Mann zusammenarbeitete. Nach dem „Anschluß“ gelang dem Ehepaar Kraus die Emigration nach Frankreich. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Qualifikationen konnten beide in ihrer Branche Fuß fassen und wurden von der in Avignon (im zunächst nicht von der Wehrmacht besetzten Teil Frankreichs) ansässigen Firma Naquet angestellt. Welche Position sich Kraus bei Naquet erarbeiten konnte, zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass die Firma sogar auf ihrem Briefpapier angab, das von ihm entwickelte technische Verfahren („Procédés F. Kraus, Ingenieur Diplomé“) einzusetzen.
Bei einer der vielen antijüdischen Razzien des Jahres 1942 geriet auch Kraus in die Fänge der französischen Kollaborateure der Nazis. Er wurde verhaftet, Ende August im Lager Les Milles interniert und über das Sammellager Drancy am 7. September nach Auschwitz deportiert, wo er am drei Tage später ermordet wurde. Mit dem gleichen Transport wurde auch sein Schwager, der Dentist Rudolf Bettelheim, deportiert und ebenfalls ermordet. Noch während der Zeit der Internierung und der Deportation, ja sogar noch nach seinem Tod (der nicht publik geworden war), hatte die Fa. Naquet mit Bittschreiben an die Präfektur versucht, ihren Mitarbeiter zu retten.
Die schreckliche Geschichte der Familie Kraus ist eine Geschichte der kompletten Auslöschung durch die NS-Mordpolitik: Friedrichs Witwe Gisela wurde im Juni 1943 verhaftet, im Gestapogefängnis von Marseille gefoltert, dann nach Auschwitz deportiert und unmittelbar nach ihrer Ankunft am 25. November 1943 vergast. Friedrichs Eltern Leopold und Malvine waren bereits am 3. Dezember 1941 aus einer Sammelwohnung in der Ägidigasse nach Riga deportiert und dort sofort erschossen worden. 1942 wurden auch der Firmengründer Richard Koref und seine Gattin Rosa deportiert, und zwar nach Izbica, und ebenfalls sofort ermordet. Nur Ing. Ernst Koref gelang die Emigration nach Brasilien.
Dass die Erinnerung an Kraus aufrechterhalten wird, ist nicht zuletzt Wilhelm Bettelheim, einem Neffen von Gisela Kraus, zu verdanken: Auf seinen Informationen baut auch der vorliegende Artikel auf. Das Archiv der TU Wien wird in den nächsten Monaten im Rahmen eines Gedenkportals mit einer Vielzahl von Kurzbiographien versuchen, diese Erinnerung zu fördern und zu unterstützen.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 48 / Oktober 2018
Josef Stummer wurde am 18. März 1808 als Sohn eines Baumeisters in Korneuburg geboren. In den Jahren 1823 bis 1827 studierte er an der technischen Abteilung des polytechnischen Instituts, der heutigen TU Wien, zeitgleich absolvierte er eine Maurerlehre im Betrieb seines Vaters, danach wechselte er an die Akademie der Bildenden Künste, um bei Peter Nobile Architektur zu studieren. 1831 kehrte er ans polytechnische Institut zurück und wurde Assistent für Baukunst. Diese Stelle hatte er bis 1835 inne und bereits ein Jahr später erfolgte seine Berufung zum Professor für Bauwissenschaften und Baubuchhaltung. Stummer war aber nicht nur als Lehrender tätig, sondern immer wieder auch als Architekt an zahlreichen Bauprojekten beteiligt. Bereits 1836 begann der umfangreiche Ausbau des Hauptgebäudes am Karlsplatz unter seiner Leitung. Stummer gestaltete die Quertrakte und den Mitteltrakt zwischen Hof 1 und 2, den Panigl-, den Lammtrakt sowie den Pavillon im Hof 2. Dieser Pavillon wurde extra für die 2. Gewerbsproduktenausstellung 1839 errichtet und später für Unterrichtszwecke adaptiert; heute befindet sich dort der Hörsaal VII.
Josef Stummer spezialisierte sich von Anfang an auf das Entwerfen von technischen Nutzbauten, wie etwa dem Bahnhof der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, dem Regierungsgebäude der Niederösterreichischen Statthalterei in der Herrengasse oder der Hauptpost am Fleischmarkt. Darüber hinaus war er auch im administrativen Dienst bei verschiedenen Eisenbahngesellschaften tätig, z. B. war er ab 1843 Direktor der Kaiser Ferdinands-Nordbahn (die von Wien bis nach Krakau ging) und ab 1856 Vizepräsident der Carl Ludwig Bahn (die Strecken in Galizien, heute in Polen und in der Ukraine). Nach mehr als 30 Jahren als Professor am polytechnischen Institut ging Stummer auf eigenen Wunsch 1867 in den vorzeitigen Ruhestand, um ausschließlich für die Eisenbahn tätig sein zu können.
Zehn Jahre später begann er mit dem Verfassen seiner umfangreichen Tagebücher, in der uns heute vorliegenden Form. Unter Verwendung früherer Notizen berichtete er sowohl von privaten als auch beruflichen Ereignissen aus seinem Leben und seinem Umfeld. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von zwölf Bänden, einem Reisetagebuch und einem Band mit Literaturzitaten sowie zwei Indices. Zeitlich gehen die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1849 zurück und wurden bis kurz vor seinem Tode fortgeführt. Man findet darin Erinnerungen an Ausflüge, wissenschaftliche Vorträge, zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, aber auch Krankheitsfälle in der Familie und sogar den Beginn einer Liebesbeziehung.
Er berichtete z. B. von einem Ausflug auf den Semmering vom 6. bis 8. September 1854. Stummer besichtigte mit seiner Familie und dem Professor für Darstellende Geometrie Johann Hönig die gerade eröffnete Semmeringbahn. Am 7. September 1854 führten einige am Bau beteiligte Ingenieure, ehemalige leider nicht namentlich genannte Schüler, durch den Bauabschnitt von Gloggnitz bis zum Haupttunnel. Vielleicht war einer davon der spätere persische Gesandte und österreichische Honorarkonsul Gasteiger Khan. Einige Jahre nach seinem Studium, von 1850 bis 1854, war Albert Gasteiger als Ingenieurassistent beim Bau der Semmeringbahn tätig. Aus einem späteren Tagebucheintrag aus dem Jahr 1873 geht hervor, dass sich die beiden Herren näher gekannt haben.
Der ehemalige Schüler Rudolf Sonndorfer hielt in Stummers Wohnung an drei Sonntagen im Winter 1863 für „14 bis 15 junge Damen, welche öfter zu Unterhaltungen zu uns kamen“ Vorträge über Astronomie. Diese sollten so neben „Tanz- und Spiel-Unterhaltungen“ auch „bisweilen populärwissenschaftliche Vergnügungen erhalten“, so Stummer in seinem Tagebucheintrag vom 16. März 1863.
Auch seine beruflichen Erfolge fanden ihren Niederschlag, wie z. B. die von ihm verfasste „Bildliche Darstellung der Geschichte der Kaiser Ferdinands-Nordbahn“, ein geschichtlicher Abriss der Entwicklung der Bahnlinie, der nationale und internationale Anerkennung erntete. Im Rahmen der Generalversammlung der Bahn am 27. April 1853 wurde das sogenannte „Nordbahn-Tableau“ prämiert und beschlossen, es vervielfältigen zu lassen. Hierfür verlieh ihm Kaiser Franz Joseph 1855 die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft, auf den zwei Weltausstellungen in Paris 1855 und in London 1862 erhielt der Autor jeweils die Medaille I. Classe. Ein ganzes Buch widmet Stummer der Eröffnung des Suez-Kanals am 17. November 1869 und seiner teilweise recht mühevollen Reise durch Ägypten, die er im Anschluss daran unternahm.
Neben den beruflichen Ereignissen hielt Stummer aber auch zwischenmenschliche Beziehungen für erwähnenswert, so konnte sich manchmal aus freundschaftlichen Zusammenkünften auch mehr ergeben. Der aufmerksame Beobachter schrieb am 15. April 1863 von einem „zarten Verhältnis“ zwischen seinem Assistenten der Landbauwissenschaft, Eduard Stix, und seiner Nichte Auguste Krause, „welches in kürzerer Zeit eine förmliche Bewerbung von Seite Stix zur Folge haben dürfte.“ Stummer sollte Recht behalten: im April 1864 hält Stix um ihre Hand an.
Die Tagebücher von Josef Stummer von Traunfels geben spannende Einblicke in einen großbürgerlichen Haushalt des 19. Jahrhunderts und in das ausgefüllte Leben eines viel beschäftigten Mannes, der sowohl in der technischen Ausbildung als auch in der Praxis „daheim“ war.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Tagebücher von Josef Stummer
Die Tagebücher von Josef Stummer,
Foto (c): Thomas Györik, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 47 / Juni 2018
Von all den Jahren, an die 2018 erinnert wird, erscheint die österreichische Erinnerung an „1968“ vergleichsweise vage und unbestimmt. Sie ist auch mit keinen nennenswerten innenpolitischen Umbrüchen verbunden. Hat die mit diesem Jahr eng verknüpfte Bewegung hierzulande überhaupt eine relevante Rolle gespielt? Und wenn ja, war auch unsere Universität davon betroffen?
Auf diese Frage gibt es für die Technische Hochschule mehrere Antworten: Ob Studierende direkt in die 1968er-Bewegung involviert wurden, war unter anderem von der Fakultät, an der sie inskribiert waren, abhängig. An der Architektur wurde man geradezu zwangsweise in die heftigen Auseinandersetzungen um die Lehrveranstaltung „Tendenzen der Gegenwartsarchitektur“ des Lehrbeauftragten Günther Feuerstein hineingezogen. Feuerstein war zunächst Assistent von Karl Schwanzer, der zentralen Persönlichkeit der Architekturausbildung an der TH in den 1960er und 1970er Jahren (dessen 100. Geburtstag in den letzten Wochen in einigen Tageszeitungen ausführlich gewürdigt wurde). Ab 1966 hatte Feuerstein den genannten Lehrauftrag inne. Diese Lehrveranstaltung wurde zum Versammlungsort für avantgardebegeisterte, fortschrittlich orientierte (das ist nicht nur politisch gemeint) Studierende. Für die Gründung von Architektengruppen wie ZÜND-UP, Haus-Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au waren die Lehrveranstaltungen von Feuerstein und Schwanzer jedenfalls entscheidend.
Als 1968 bekannt wurde, dass Feuersteins Lehrauftrag nicht mehr verlängert werden sollte (seine unkonventionelle Einladungspolitik hatte einigen Professoren missfallen), kam es zu studentischen Protesten, die Ende 1968/Anfang 1969 immer aktivistischer wurden und auch in der Tagespresse große Resonanz erhielten. Ein Höhepunkt war im März 1969 die Ausgestaltung der Zeichensäle mit einer Reihe von Wandzeitungen und –zeichnungen, für die ein studentisches Aktionskomitee verantwortlich zeichnete. Eine Protestform, die es so zuvor an der TH noch nicht gegeben hatte. Nach langem Hin und Her wurde der Lehrauftrag an Feuerstein für das Studienjahr 1969/70 wieder erteilt.
Unterschwellig legte man Feuerstein auch den Fall „Otmar Bauer“ zur Last: Der aus Oberösterreich stammende Architekturstudent war der einzige im Jahr 1968 Inskribierte, der an der Aktion „Kunst und Revolution“ am 7. Juni 1968 im NIG, Hörsaal I, auf der Bühne teilgenommen hatte. Seine Rolle war nicht auffällig, aber alleine die aktive Teilnahme an der bald „Uniferkelei“ genannten Aktion brachte Bauer, der ebenfalls bei Feuerstein gehört hatte, in vielfältige Kalamitäten: Seine Familie brach mit ihm, er wurde polizeilich gesucht und schließlich auch von der Technischen Hochschule verwiesen. Als Ankläger in Bauers Disziplinarverfahren agierte übrigens Prof. Heinrich Sequenz, seines Zeichens letzter Rektor der TH in Wien im Nationalsozialismus. Bauer nahm sein Studium nicht mehr auf, wurde Gründungsmitglied der Mühl-Kommune, brach aber später mit Otto Mühl und trat in dessen Prozeß als Belastungszeuge auf. Knapp vor seinem Tod 2004 beschrieb er in der eindringlichen Autobiographie mit dem Titel „1968“ unter anderem auch seine Erfahrungen an der TH in Wien.
Erfahrungen wie Otmar Bauer machten aber selbstverständlich die wenigsten Angehörigen der TH in Wien. Die intensiven Diskussionen um Modernisierung und Reform waren aber allgegenwärtig. Diese Reformen konnten technisch, hochschulpolitisch oder gesellschaftlich sein: 1968 wurde erstmals die Inskriptionsverwaltung auf ein auf Lochkarten basiertes EDV-System umgestellt. Das Technikstudiengesetz, das 1969 beschlossen wurde und endlich auch die Akademisierung der technischen Studien durchsetzte, wurde sowohl von den Lehrenden als auch von den Studierenden breit diskutiert. Letztlich wurden die alten Staatsprüfungen durch das Diplomprüfungssystem ersetzt. Ebenfalls 1968/69 geschahen entscheidende Initiativen zur Einrichtung von bis heute wichtigen Studienrichtungen wie „Informatik“ oder „Raumplanung und Raumordnung“. Und auch die Einführung von Institutskonferenzen und Studienkommissionen mit einer studentischen Drittelparität wurde bereits 1969 umgesetzt. Reformen waren überall spürbar – eine Revolution ist aber ausgeblieben.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 46 / April 2018
Am 11. April 2018 jährte sich Otto Wagners Todestag zum 100. Mal. Mit dem berühmten Architekten assoziiert man in erster Linie prägende Bauwerke der Moderne wie etwa die Wiener Stadtbahn, die Postsparkasse oder die Kirche am Steinhof. Kaum bekannt ist, dass Wagner den Grundstock seines Wissens unter anderem am k. k. polytechnischen Institut erhielt, der heutigen TU Wien.
Otto Koloman Wagner wurde am 13. Juli 1841 in Penzing (bis zur Eingemeindung 1892 noch ein Vorort von Wien) geboren. Er wohnte mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Emerich in der Seilergasse im ersten Bezirk. Ottos Vater Simeon Wagner, königlich-ungarischer Hofnotar, starb bereits 1846, fortan lebten die Buben nur bei ihrer Mutter Susanna. Ungeachtet der folgenden finanziellen Einschränkungen sollten die Söhne jedoch eine gute Ausbildung erhalten.
Zunächst wurde Otto einige Zeit von Hauslehrern unterrichtet, dann wechselte er für zwei Jahre ans Akademische Gymnasium in Wien, und 1855 schließlich an das von Benediktinern geführte Stiftsgymnasium Kremsmünster in Oberösterreich, das für seine gute humanistische Ausbildung bekannt war. Aber auch hier blieb Otto Wagner nur zwei Jahre; im Sommer 1857 kam er wieder nach Wien, um am k. k. polytechnischen Institut zu studieren. Um hier ein Studium beginnen zu dürfen, musste man mindestens 16 Jahre alt sein, eine Schule abgeschlossen haben oder man benötigte – wie heute allgemein üblich – ein Matura- bzw. „Maturitätszeugnis“ nach dem damaligen Sprachgebrauch. Da er kein entsprechendes Dokument besaß und auch den am polytechnischen Institut angebotenen Vorbereitungskurs nicht besucht hatte, musste die Reifeprüfung noch vor Beginn des Studienjahres abgelegt werden.
In einem Schreiben vom 1. Juli 1857 an die Direktion ersuchte Susanna Wagner, ihrem Sohn Otto, der „4 Gymnasial-Klassen mit gutem Erfolge gemacht hat; sich aber jetzt […] den technischen Studien widmen will, die [Ablegung der] Maturitäts-Prüfung“ zu bewilligen. Auf der Rückseite des Schreibens, das im Archiv der TU Wien erhalten ist, sind die vorgeschriebenen Gegenstände mit den jeweiligen Terminen vermerkt, die Unterschriften der Professoren und nicht zuletzt die Noten. Während Otto Wagner Prüfungen in Zeichnen, Stilistik, Mathematik und Experimentalphysik jeweils mit gutem bzw. sehr gutem Erfolg abschloss, reichte es in Naturgeschichte nur für genügenden Erfolg. Die genauen Modalitäten der Tests sind nicht mehr erhalten, Wagner war aber nicht der einzige, der um die Zulassung ansuchte – so sind im Protokollbuch der Rektoratsakten aus dem Studienjahr 1857 noch über 120 weitere Namen angeführt.
Somit durfte der erst 16-jährige Otto Wagner im Studienjahr 1857/58 am polytechnischen Institut inskribieren. Es herrschte Lehr- und Lernfreiheit, das heißt, die (in dieser Zeit noch ausschließlich männlichen) Studenten konnten Vorlesungen nach ihren Wüschen und Interessen frei auswählen und sich so einen persönlichen Studiengang zusammenstellen. In seinem ersten Studienjahr belegte Wagner Vorlesungen der technischen Abteilung über Elementar-Mathematik, Technologie und Zeichnen, im folgenden (1858/59) Höhere Mathematik, Physik, Darstellende Geometrie sowie Konstruktives Zeichnen. Drei der Lehrenden kannte er schon von der Maturitätsprüfung: den langjährigen Professor für Darstellende Geometrie Johann Hönig, den Mathematiker Josef Kolbe und den Physiker Ferdinand Hessler.
Es war auch damals schon üblich, ein „Auslandsjahr“ einzulegen, so ging Wagner nach zwei Jahren am polytechnischen Institut, wo er kein einziges Baufach inskribiert hatte, nach Berlin an die königliche Bauakademie, um dort sein Wissen zu erweitern. Danach kam er wieder nach Wien zurück, besuchte 1860 bis 1862 die Architekturklasse der k. k. Akademie der bildenden Künste bei Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg und begann danach seine Karriere als Architekt der Moderne.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien
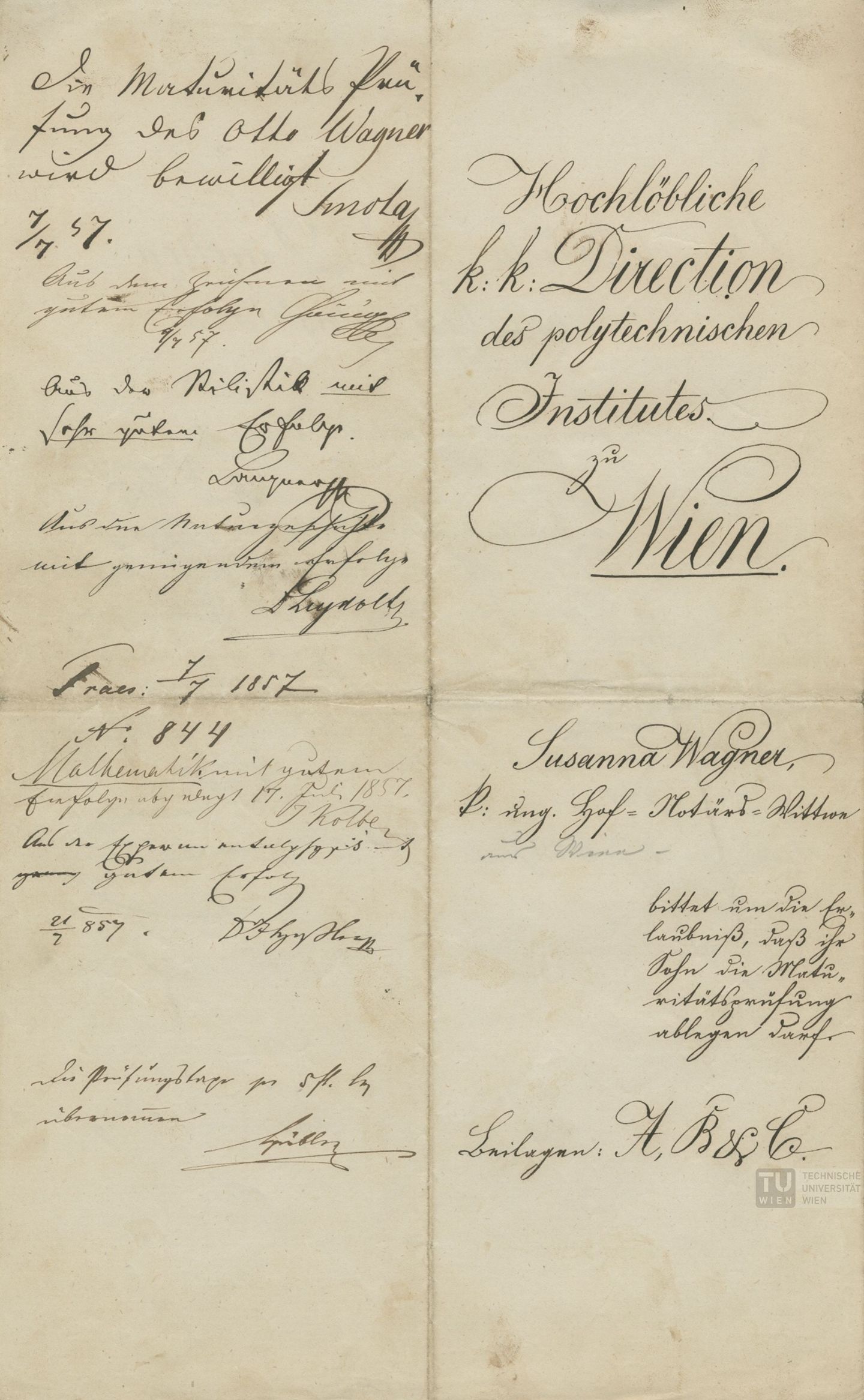
Maturazeugnis Otto Wagner
RZl. 844/1857 (Maturazeugnis von Otto Wagner),
(c) Foto: Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 45 / Februar 2018
Ernst Winter wurde am 7. November 1904 in Wien in eine säkularisierte jüdische Familie geboren. Der Vater, KR Julius Winter, war Kaufmann und Vizepräsident des Wiener Kaufmännischen Vereins, die Mutter starb früh. Winter besuchte 1915-1923 das Akademische Gymnasium in Wien, danach die Maschinenbauschule an der TH in Wien, an der er 1930 die II. Staatsprüfung aus Elektrotechnik ablegte.
Von November 1931 bis August 1933 war Winter in einem Forschungslabor in Wien beschäftigt. Im September 1933 entschloss er sich, wohl aufgrund der angespannten wirtschaftlichen und politischen Situation in Österreich (er war Sozialdemokrat), nach Palästina zu emigrieren. Dort heiratete er die Wienerin Gertrude Adler, die Hauptschullehrerin für jüdische Religion war, und konnte beruflich Fuß fassen, unter anderem als Sachverständiger in Versicherungsangelegenheiten.
Nach drei Jahren kehrte Winter mit seiner Frau nach Wien zurück und war als Versicherungsexperte bei der Anglo-Elementar Versicherungs-AG tätig. Der „Anschluss“ Österreichs im März 1938 bedeutete in seinem Leben eine tiefe Zäsur. Ende Juni 1938 von der Anglo-Elementar entlassen, wurde er im Zuge des Novemberpogroms von der SA aus seiner Wohnung vertrieben. Seine intensiven Bemühungen um Ausreise blieben lange erfolglos. Ein Affidavit für die USA wurde von den amerikanischen Behörden nicht akzeptiert, auch seine körperliche Behinderung (ein Arm war von Geburt an deformiert) wurde gegen ihn ins Treffen geführt. Erst Ende Juni 1939 gelang es ihm, jedoch ohne seine Frau, mit einem trainee permit nach England zu entkommen.
Wie die anderen refugees wurde Winter hier vom Kriegsausbruch eingeholt. Ab Mai 1940 kam es zu Masseninternierungen von feindlichen Ausländern, denen auch er zum Opfer fiel. Er wurde Ende Juni im Lager Huyton bei Liverpool interniert und am 10. Juli gemeinsam mit etwa 2.500 Ex-Österreichern, Deutschen und Italienern auf der HMT Dunera auf eine Reise mit unbekannter Destination zwangsverschickt. Die hygienischen Verhältnisse auf dem komplett überbelegten Transporter waren katastrophal; die Männer wurden durch die Wachmannschaft ihrer wenigen mitgebrachten Habseligkeiten beraubt und waren ärgsten Schikanen ausgeliefert. Erst spät stellte sich heraus, dass die Dunera nicht, wie angenommen, Kanada, sondern Australien ansteuerte, das sich bereit erklärt hatte, eine größere Zahl an Internierten von den Briten zu übernehmen.
Im September konnte Winter endlich mit dem Großteil seiner Schicksalsgenossen, die sich später Dunera Boys nannten und unter denen sich auch eine Reihe weiterer Alumni der TH Wien befanden, in Sydney an Land gehen und wurde in das Lager Hay, im Outback von New South Wales, transportiert. Hier war er bis Mai 1941 unter extremen klimatischen Bedingungen interniert, ehe er in das Lager Tatura im Bundesstaat Victoria überstellt wurde.
Wie bereits auf der Dunera bauten die Flüchtlinge in beiden Lagern rasch ein kulturelles und intellektuelles Leben auf. In Lagerschulen wurden wissenschaftliche und praktische Kurse angeboten. Winter engagierte sich aktiv in der Organisation der Schulen und unterrichtete auch selbst, unter anderem technisches Zeichnen und Werkstoffkunde.
Im August 1942 konnte er das Lager on parole verlassen, um in Melbourne eine Stelle als Maschinenbauer anzutreten, wechselte aber schon im folgenden Jahr als Konstruktionszeichner zu einer anderen Firma und schließlich an die University of Melbourne zum Council for Scientific and Industrial Research.
Nach Kriegsende musste Winter erfahren, dass seine Frau und seine nächsten Angehörigen in der Shoah ermordet worden waren. Er entschied sich in Australien zu bleiben und schloss später eine zweite Ehe, aus der zwei Kinder hervorgingen. Beruflich war er bis zu seiner Pensionierung 1969 als Konstrukteur und Maschinenbauer tätig, zuletzt beim staatlichen Commonwealth Department of Supply.
Er verstarb in Melbourne am 24. Jänner 1984. Der aus seiner Heimatstadt Wien Vertriebene hatte in Australien eine zweite, endgültige Heimat gefunden. Nach Österreich ist er nie wieder zurückgekehrt.
Elisabeth Lebensaft & Antonia Lehn
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 44 / Oktober 2017
Am 20. Juni 2017 wurde der höchste albanische Orden „Ehre der Nation“ posthum an den Bauingenieur Dipl. Ing. Kujtim Ali Beqiri verliehen. Der albanische Staatspräsident Bujar Nishani überreichte die Auszeichnung stellvertretend an die Familie des an unserer Universität ausgebildeten Ingenieurs.
Das kurze Leben von Kujtim Ali Beqiri (in unseren Akten „Kujtim Beqir“) war eng mit der Technischen Hochschule in Wien verbunden. Er wurde am 23. Februar 1916 in Vlora (in unseren Akten findet nur die italienische Bezeichnung „Valona“ Verwendung) geboren und stammte aus einer muslimischen Familie.
Erst vier Jahre vor seiner Geburt war Albanien vom Osmanischen Reich unabhängig geworden, doch der Verlauf des 1. Weltkriegs ließ den jungen Staat gleich wieder zerfallen. In den frühen 1920er Jahren konsolidierte sich das Staatswesen wieder.
Ob es die traditionell guten Beziehungen zwischen Österreich und Albanien (Österreich hatte 1912/13 die albanischen Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützt) waren, die den jungen Kujtim auf die Idee brachten, ausgerechnet in Österreich zu studieren, lässt sich nicht rekonstruieren. Tatsache ist, dass er 1935 in Waidhofen an der Thaya die Reifeprüfung abgelegt und nach seiner Zulassung im Wintersemester 1936/37 das Studium des Bauingenieurwesens an der TH in Wien begonnen hat. Besonders attraktiv präsentierten sich die österreichischen Hochschulen für ausländische Studenten in diesen Jahren des Kaputtsparens der Universitäten aber nicht: So war Beqiri 1936 einer von nur zwei albanischen Studenten an der TH und der einzige Moslem an der Fakultät für Bauingenieurwesen. Er war den österreichischen Studierenden gleichgestellt und von der Studiengebühr befreit.
Sein Studium absolvierte der junge Albaner in der Mindestzeit. Am 31. Oktober 1938 legte er die I. Staatsprüfung mit „Sehr gutem Erfolg“ ab, am 25. Juli 1940 dann die II. Staatsprüfung. Somit erwarb er den Titel eines „Diplom Ingenieurs“.
Nach Beendigung des Studiums ging er in seine Heimat zurück, obwohl es den albanischen Staat inzwischen nicht mehr gab. 1939 hatten die italienischen Faschisten das Land besetzt, den König vertrieben, eine Marionettenregierung eingesetzt und von hier aus 1940 den Krieg in Griechenland angezettelt. Beqiri war von 1940 bis 1944 in führender Rolle an wichtigen Bauvorhaben tätig und gründete eine Familie.
Nach der Vertreibung der italienischen und deutschen Truppen etablierte sich bereits ab 1944 ein kommunistisch geprägtes Regime unter Enver Hoxha, das sehr schnell zur Einparteiendiktatur wurde und alle potentiellen Gegner verfolgte.
Beqiri konnte zunächst als Experte weiterarbeiten, er war sogar leitender Ingenieur bei einem großen Prestigeprojekt des kommunistischen Albaniens, der Trockenlegung der Maliq-Sümpfe in der Korca-Region. 1946 wurde er unter fadenscheinigen Anschuldigungen verhaftet, in einem Schauprozeß, der vom 6. bis 19. November dauerte, zum Tode verurteilt und am 22. November gehängt. Ein Schicksal, das seit den späten 1920er Jahren Technikern und Ingenieuren, besonders wenn sie im Westen ausgebildet worden waren, in allen stalinistischen Regimes drohte.
In den letzten Jahren haben sich Angehörige von Beqiri und auch die albanische Botschaft an das Universitätsarchiv gewandt, um Details zu seinem Leben in Österreich zu erfahren. Wir danken ihnen und insbesondere Dr. Artan Canaj für die so ausgetauschten Informationen!
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 43 / Juni 2017
2017 feierte das Fahrrad seinen 200. Geburtstag, einer der Konstrukteure seinen 250.
Ein schnelles Fahr- und Transportmittel von A nach B, bequem und gut für die Gesundheit – so wurde ein heute allerorts bekanntes Fortbewegungsmittel bereits vor 200 Jahren angepriesen. Die Bezeichnung „Fahrrad“ war zu dieser Zeit allerdings noch unbekannt.
Was später unter der Bezeichnung „Fahrrad“ bekannt wurde, verbindet man in erster Linie mit Karl Freiherrn von Drais (1785 – 1851), einem aus Karlsruhe stammenden Oberforstmeister. Er hatte 1817 neben zahlreichen weiteren Erfindungen auch eine Laufmaschine entwickelt; erste Überlegungen gehen bereits auf das Jahr 1813 zurück. Um sein Produkt – von ihm selbst Draisine genannt – möglichst gut verkaufen zu können, schaltete er Zeitungsinserate und veranstaltete öffentliche Vorführungen sowie zahlreiche Probefahrten. Bereits 1818 war eine Broschüre auf dem Markt, in der Funktion und Verwendung seiner Erfindung detailgenau beschrieben wurden – mit der Folge, dass die Maschine vielerorts einfach nachgebaut wurde. Um dies zu unterbinden, versuchte von Drais, sein Werk durch ein Erfindungsprivileg schützen zu lassen und suchte in mehreren Ländern Europas darum an. Am 12. Jänner 1818 erhielt er ein Privileg für sein Laufrad – die Erfindung war forthin geschützt, jedoch nur für den deutschen Landkreis Baden.
In Wien reichte von Drais schon im November 1817 bei der k. k. Kommerzhofkommission seine Erfindung ein, um sie für die gesamte Habsburgermonarchie schützen zu lassen. Die Gutachter, die von der Kommission zurate gezogen wurden, hatten die formale Vollständigkeit der Einreichung, Gesetzeskonformität sowie die Unbedenklichkeit hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit zu beurteilen, und waren allesamt Professoren am k. k. polytechnischen Institut. Trotz wohlwollenden Gutachtens des Professors für Maschinenlehre Johann Arzberger der diese Erfindung zu beurteilen hatte, wurde das Privileg nicht erteilt. Der Mechanismus sei „weder im Ganzen noch in […] einzelnen Teilen“ neu, lediglich „die Art der Anordnung der zu Grunde liegenden mechanischen Vorrichtung“, diese sei aber auch vorrangig von der Geschicklichkeit des jeweiligen Fahrers abhängig und nicht so sehr vom Gerät selbst. Es waren aber auch wirtschaftliche Gründe, die dagegensprachen. Eine Erteilung des Privilegs konnte „als eine Taxentrichtung an einen Ausländer für im Inlande frey gestattete Versuche angesehen werden“ – so die Begründung im Akt Nr. 272 der niederösterreichischen Landesregierung, der am 22. April 1818 zur Kenntnisnahme ans k. k. polytechnische Institut ging.
Etwa zur gleichen Zeit und unweit der heutigen TU Wien konnten Interessierte bereits selbst auf der neuartigen Maschine ihre Runden drehen. Der Tischler und Maschinenbauer Anton Burg (1767 – 1849) war auf das Laufrad von Drais möglicherweise durch eines der zahlreichen Zeitungsinserate aufmerksam geworden und hatte beschlossen, dieses nachzubauen. Bereits 1818 bewarb er sein Produkt in der Wiener Zeitung und bot regelmäßig Vorführungen im Hinterhof seiner Werkstätte an, wo man auch gegen Gebühr selbst Probefahren konnte. Bei Gefallen waren die Erzeugnisse natürlich käuflich zu erwerben: zwischen 65 und 100 Gulden Wiener Währung pro Stück. Im Vergleich: für 1 Gulden bekam man etwa 1,2 kg Rindfleisch.
Anton Burg, der ursprünglich aus der Kurpfalz stammte, lebte seit 1790 in Wien und hatte seit 1798 seine Werkstatt auf der Wieden. Vorrangig war der „k. k. privilegierte Lederwerkzeuge und Maschinen Fabrikant“ auf landwirtschaftliche Geräte spezialisiert. Er reparierte sie, erzeugte aber auch neue und adaptierte herkömmliche Modelle. Die Konstruktion von Laufrädern war also nur ein „Nebengeschäft“, trotzdem produzierte er in den folgenden Jahren zahlreiche unterschiedliche Varianten.
1824 erhielt er gemeinsam mit Anton jun., seinem Sohn und Mitarbeiter, ein Privileg für ein selbst entwickeltes Laufrad. Hatte von Drais seine Erfindung vorrangig als kostengünstige Alternative zum Pferd vorgesehen, also zum Transport schwerer Lasten bzw. als Fortbewegungsmittel, war der Zweck des nicht unähnlichen Gefährts von Vater und Sohn Burg nun ein völlig anderer – der Gegenstand des eingereichten Privilegs war nun eine „Gesundheits- und Unterhaltungsmaschine“. Das Burg´sche Laufrad hatte – im Gegensatz zur Original-Draisine – drei Räder, zwei vorne und eines hinten; weitere Vorzüge waren „ein Polster, damit der Unterleib beym Gebrauch der Maschine nicht im mindesten eschafirt werde“ sowie ein bequemer Sitz mit Federung.
So konstruierte Burg den Vorläufer des heutigen Fahrrades nach der Idee von Drais – ein Objekt, das 1818 in Wien von so manchem skeptisch beäugt wurde – heute aber aus der Stadt nicht mehr wegzudenken ist.
Übrigens: Anton Burg hatte noch einen zweiten Sohn, Adam. Dieser trat nicht in die väterliche Firma ein, sondern ging ans k. k. polytechnische Institut, wo er Professor für Maschinenlehre wurde, in direkter Nachfolge von Johann Arzberger. Aber das wäre wieder eine neue Geschichte.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien
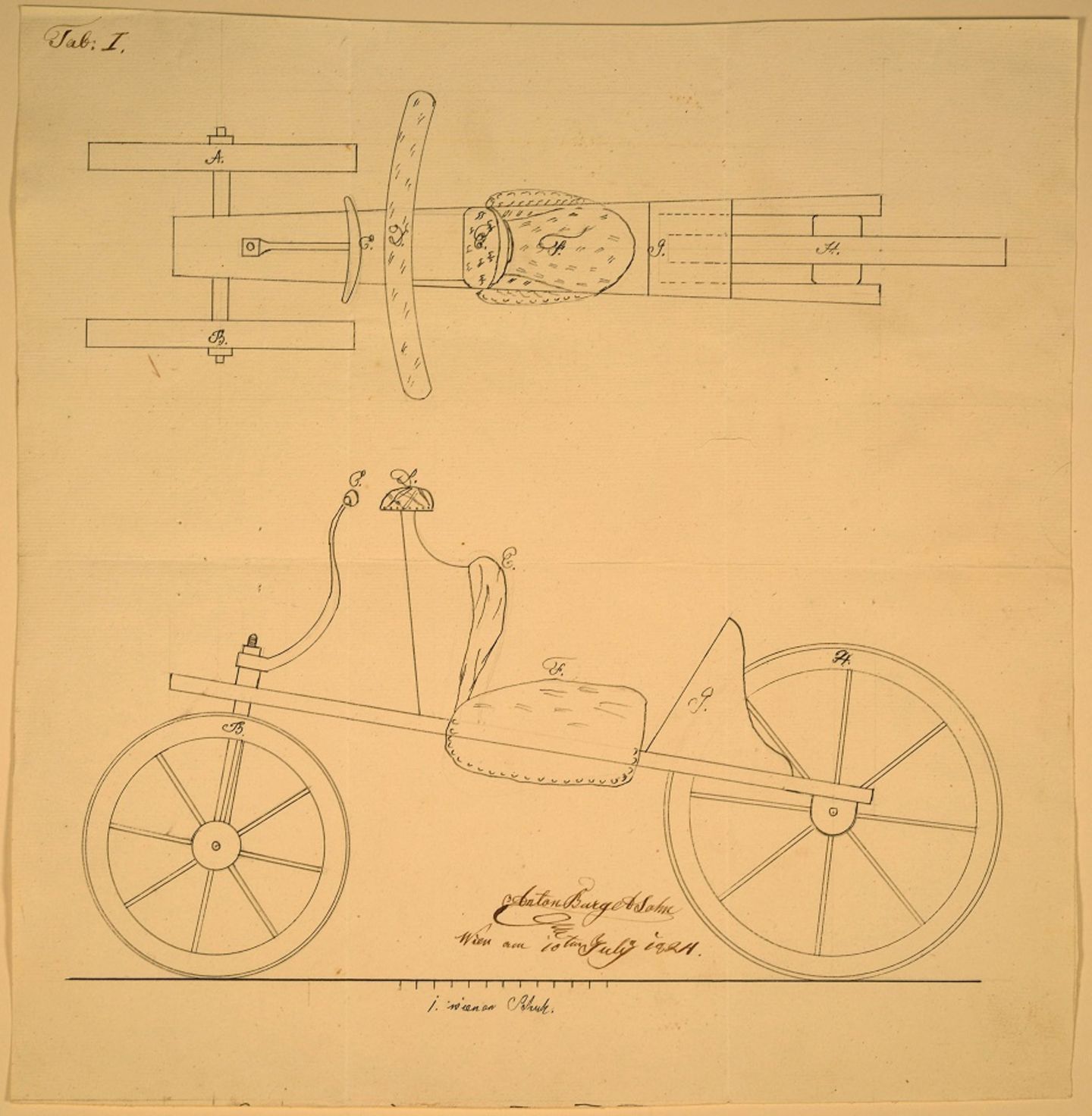
Gesundheits- und Unterhaltungsmaschine, Priv. Reg. Nr. 1002, Zeichnung 1 (aus der Sammlung von Erfindungsprivilegien),
Foto (c) Thomas Györik, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 42 / April 2017
Vor über 50 Jahren verstarb mit Josef Frank einer der bedeutendsten Architekten und Designer, die ihre Ausbildung an der Technischen Hochschule (TH) in Wien erfahren haben. Auch nach seinem Tod wird Frank ständig von neuen Generationen wiederentdeckt, so zum Beispiel 2015/16 in einer großen und vielbeachteten Ausstellung, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster im Museum für Angewandte Kunst in Wien.
Frank wurde 1885 in Baden bei Wien geboren und studierte ab 1903 an der Bauschule (später Fakultät für Architektur) der TH in Wien. 1908 legte er die II. Staatsprüfung ab. Doch damit war seine Ausbildung nicht beendet. Er nutzte die erst seit 1901 bestehende Möglichkeit, an der TH in Wien auch einen Doktortitel (Dr. techn.) zu erwerben. Seine 1910 abgeschlossene Dissertation „Über die ursprüngliche Gestalt der kirchlichen Bauten des Leone Battista Alberti“ ist dabei nicht nur von inhaltlichem Interesse. Die 20 aquarellierten Zeichnungen, die Frank von den Sakralbauten in Florenz, Mantua, Rimini und Fano angefertigt und als Beilagen zur Dissertation abgegeben hat, sind von großer Schönheit und werden regelmäßig auch in internationalen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in New York, Florenz und Stockholm.
Nach seiner Promotion nahm Frank wichtige Positionen in der österreichischen Architekturszene ein: Zunächst als Architekt in einer Bürogemeinschaft mit seinen Studienkollegen Oskar Wlach und Oskar Strnad, dann ab 1919 als Professor für Baukonstruktionslehre an der Kunstgewerbeschule (heute Universität für Angewandte Kunst) und schließlich als Mitinitiator des Einrichtungshauses „Haus und Garten“.
Bald nach dem Abschluss der von ihm als künstlerischem Leiter betreuten Arbeiten an der Werkbundsiedlung (1932) war dem Juden und Sozialisten Frank klar, dass er Österreich verlassen müsse. Deshalb wanderte er, der bereits seit den 1920er Jahren eine Vielzahl von internationalen Kontakten geknüpft hatte, 1934 nach Schweden aus, wo er zum führenden Designer der Firma „Svenskt Tenn“ wurde. Fallweise war Frank aber auch noch in Österreich tätig.
Mit dem „Anschluß“ 1938 waren die losen Verbindungen zu Österreich endgültig abgerissen: 1939 erhielt Frank die schwedische Staatsbürgerschaft, in den 1940er Jahren lebte er überwiegend in New York, wo er auch unterrichtete. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Frank nach Stockholm zurück, wo er bis zu seinem Lebensende wohnte.
Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde er 1965 in Wien mit dem „Großen Österreichischen Staatspreis für Architektur“ und einer Ausstellung in der „Österreichischen Gesellschaft für Architektur“ geehrt. Mit seiner Ausbildungsstätte, der TH Wien, gab es nach aktuellem Wissensstand nach 1945 aber keinen Kontakt. Das ist umso erstaunlicher, als Franks Ausbildung an der hiesigen Bauschule als Basis für sein gesamtes künstlerisches Leben gilt.
Aktuell findet in Stockholm eine große Ausstellung zu Franks Ehren statt, die an die Wiener Ausstellung von 2015/16 anknüpft und wie diese den Titel "Against Design" trägt.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Meldungsbuch Josef Frank, Foto: (c) Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 41 / Jänner 2017
Josef Safier, geb. am 1.2.1915 in Wien, zuständig nach Brzesko, polnischer Staatsbürger, Bauingenieurstudium an der TH in Wien, mosaischer Konfession, letzte Prüfung am 20.5.1938, dann ohne weitere Abmeldung von der TH in Wien abgegangen.
Die meisten der über 300 Biographien, die die Autor_innen der neuen Publikation des Universitätsarchivs „Abgelehnt“ … „Nicht tragbar“. Verfolgte Studierende und Angehörige der TH in Wien nach dem „Anschluß“ 1938 zu recherchieren hatten, boten ursprünglich nicht mehr Informationen als diese Zusammenfassung des Eintrags zum Bauingenieurstudenten Josef Safier im Hauptkatalog des Jahres 1935. Von diesem Wissensstand, den die im TU-Archiv aufbewahrten Akten boten, begannen Juliane Mikoletzky, Paulus Ebner und Alexandra Wieser nun mit ihren weiteren Nachforschungen.
Im Fall des Josef Safier, der nur wenige Prüfungen abgelegt hatte, gab es zunächst keine Treffer in den von uns in jedem Fall konsultierten Datenbanken wie jener von Yad Vashem oder der Opferdatenbank des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands. Schließlich fand Alexandra Wieser ein Foto eines Grabes in Bremen, bei dem nicht nur der Name sondern auch das Geburtsdatum mit unserem Studenten übereinstimmte. Einige Rechercheschritte später stieß sie auf den Namen des höchst erfolgreichen deutschen Schriftstellers David Safier („Mieses Karma“, „Jesus liebt mich“, „28 Tage lang“). Über den Rowohlt-Verlag konnte sie sehr schnell Kontakt herstellen: Gleich in seinem ersten Mail bestätigte uns der Autor, dass es sich bei Josef Safier um seinen Vater handelt. Er bot auch seine Unterstützung an, verfasste einen kurzen Lebenslauf und zeigte sich sehr interessiert an unserer Arbeit. Da sich David Safier bei der Kontaktaufnahme gerade auf einer Lesereise befand, die ihn auch nach Wien führte, wurde an einem freien Vormittag ein Termin für einen Archivbesuch vereinbart. Am 22. November 2016 traf der Bremer Autor in unserem Archiv ein, mit dabei hatte er das Studienbuch seines Vaters (das Foto aus diesem Dokument ist in der Broschüre des Universitätsarchivs abgebildet).
Josef Safier hat seinem Sohn nicht sehr viel über die Studienzeit erzählt, berichtete aber doch von gewalttätigen Übergriffen auf die jüdischen Studenten nach dem „Anschluß“. Letztlich erwies sich der Austausch von Informationen als sehr produktiv. David Safier war zum Beispiel nicht bewusst, dass sein Vater, obwohl in Wien geboren, bei seinem Studium die polnische Staatsbürgerschaft besaß, auch die Berufsbezeichnung des in der Shoah ermordeten Großvaters war ihm nicht bekannt. Diese lautete nämlich auf „Agent“ – also eine Art Handelsvertreter. Dafür konnte er den Archivmitarbeiter_innen eine Vielzahl von Informationen zum höchst abenteuerlichen Leben seines Vaters nach der Flucht aus Österreich geben. Josef Safier wurde zwar nie Bauingenieur, diente aber als Soldat im jungen Staat Israel, ging danach als Zahlmeister zur See und wurde schließlich in Bremen Gastwirt und Familienvater. Wenige Tage vor seinem Besuch in Wien hatte David Safier im deutschen Nachrichtenmagazin „Focus“ einen kurzen biographischen Abriss seines Vaters verfasst.
Obwohl es außer dem Eintrag im Hauptkatalog keine weiteren Dokumente zu Josef Safier in unserem Archiv gibt, entwickelte sich ein intensives Gespräch, das ganz sicher nicht von „miesem Karma“ geprägt war. Wie mit David Safier konnte das Universitätsarchiv auch mit anderen Nachkommen von vertriebenen Studierenden Kontakt aufnehmen. Auch diese, meist nur schriftlichen, Begegnungen verliefen sehr positiv und zeigen eindringlich, wie notwendig die Beschäftigung mit ganz persönlichen Schicksalen für die Schaffung eines schlüssigen Gesamtbildes dieser Epoche ist.
Nicole Schipani, Fundraising & Community Relations

David Safier und die Mitarbeiter_innen des Archivs, Juliane Mikoletzky, Alexandra Wieser und Paulus Ebner, blicken in den Hörerkatalog, Foto: (c) Nicole Schipani
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 40 / Oktober 2016
Mit dem Ankauf der Loséschen Gründe „auf der Wieden Nr. 1“ war ein Platz für das neu gegründete k.k. polytechnische Institut gefunden. Während die Lehrveranstaltungen noch im alten Palais stattfanden, waren die Bauarbeiten für das neue Gebäude davor bereits in vollem Gange. Als die Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung am 14. Oktober 1816 um 12 Uhr mittags stattfanden, war die „neue TU“ bereits bis zum Dach fertiggestellt.
Damals noch vor den Toren der Stadt gelegen, befand sich auf dem Areal für das polytechnische Institut, genauer gesagt am Vorplatz, ein Trödlermarkt mit über 100 Buden. Für den festlichen Anlass mussten diese Trödlerhütten weichen. Sie wurden aber nicht komplett entfernt, sondern nur an den Mondscheinsteg – besser bekannt als Heu-, Mondschein- oder Schwarzenbergbrücke am heutigen Schwarzenbergplatz – verlegt. Da der Bau schon weit fortgeschritten war, sollten eine Haupt- und mehrere Seitentribünen, eine Galerie für die hohen Herrschaften im Vestibül sowie zwei Zelte Platz für rund 5.000 Personen schaffen. Rote Eintrittskarten galten ausschließlich für die Tribünen, weiße für weitere Sitz- und blaue für die Stehplätze.
Der würdevolle Ablauf fand, wie im Commissionsprotokoll vom 11. September 1816 akribisch festgehalten, statt: Mit Pauken und Trompetenschall wird Kaiser Franz I. mit seinem Hofstaat vor dem Rohbau empfangen und von Graf Alois von und zu Ugarte, dem Präsidenten der k.k. Studienhofkommission, direkt in das erste Festzelt geleitet. Dort liegen Pläne und Zeichnungen des Gebäudes zur Ansicht bereit, ebenso wie zahlreiche Münzen, darunter auch speziell für diesen Festakt geprägte Gedenkmünzen in Gold und Silber, Maurerutensilien – eine Kelle, ein Hammer und eine speziell für diesen Anlass angefertigte Mörteltruhe aus Holz mit Greifverzierungen (siehe Abbildung) – sowie eine Pergamentrolle mit dem Ablauf der Zeremonie.
Kaiser Franz I. schreitet in der mit edlen Stoffen und Tapeten ausgekleideten Baugrube im Vestibül zur Tat, wo er schon vom Erzbischof von Wien, Sigismund von Hohenwart, zwölf Priestern des Ordens der Kreuzherren und zwei Diakonen erwartet wird. In eine Vertiefung des bereitstehenden Grundsteins werden die zuvor vom Kaiser sowie einigen hohen Beamten als Zeugen unterzeichnete Pergamentrolle gemeinsam mit den Münzen gelegt und mit einer silbernen Platte verschlossen. Nach der Segnung durch den Erzbischof mauert der Kaiser den Grundstein höchstpersönlich ein „mittelst der Ziegel und des Mörtels, wozu der Hammer und die Kehle vom Baumeister […] dieses Gebäudes […] Herrn Hofcommisions-Rath von Schemerl […] dargereicht wird“, so das Protokoll aus dem Archiv der TU Wien.
Nach dieser feierlichen Handlung verlassen die hohen Herrschaften die Baugrube wieder, es folgt eine Dankesrede von Johann Joseph Prechtl, dem ersten Direktor und Gründungsvater des k.k. polytechnischen Instituts. Der Vortrag eines speziell zu diesem Anlass von Heinrich Joseph von Collin verfassten Gedichts durch einen Studenten bildet den Abschluss der Feier. Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Moment wird außerdem noch eine gedruckte Version dieses Gedichts an die anwesenden Festgäste verteilt.
Im Laufe der Jahre hat sich viel im und um das Hauptgebäude der heutigen TU verändert, bis heute werden Hörsäle erweitert, Büros umgebaut und Zugänge adaptiert. Der Grundstein, und mit ihm die wertvollen Gegenstände, befindet sich aber immer noch an der vom Kaiser persönlich eingemauerten Stelle: unter dem ersten Pfeiler in der Eingangshalle des Hauptgebäudes gleich links.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien

Mörteltrog
Mörteltrog, benutzt im Rahmen der Feier zur Grundsteinlegung,
Foto (c) Thomas Györik, Archiv der TU Wien
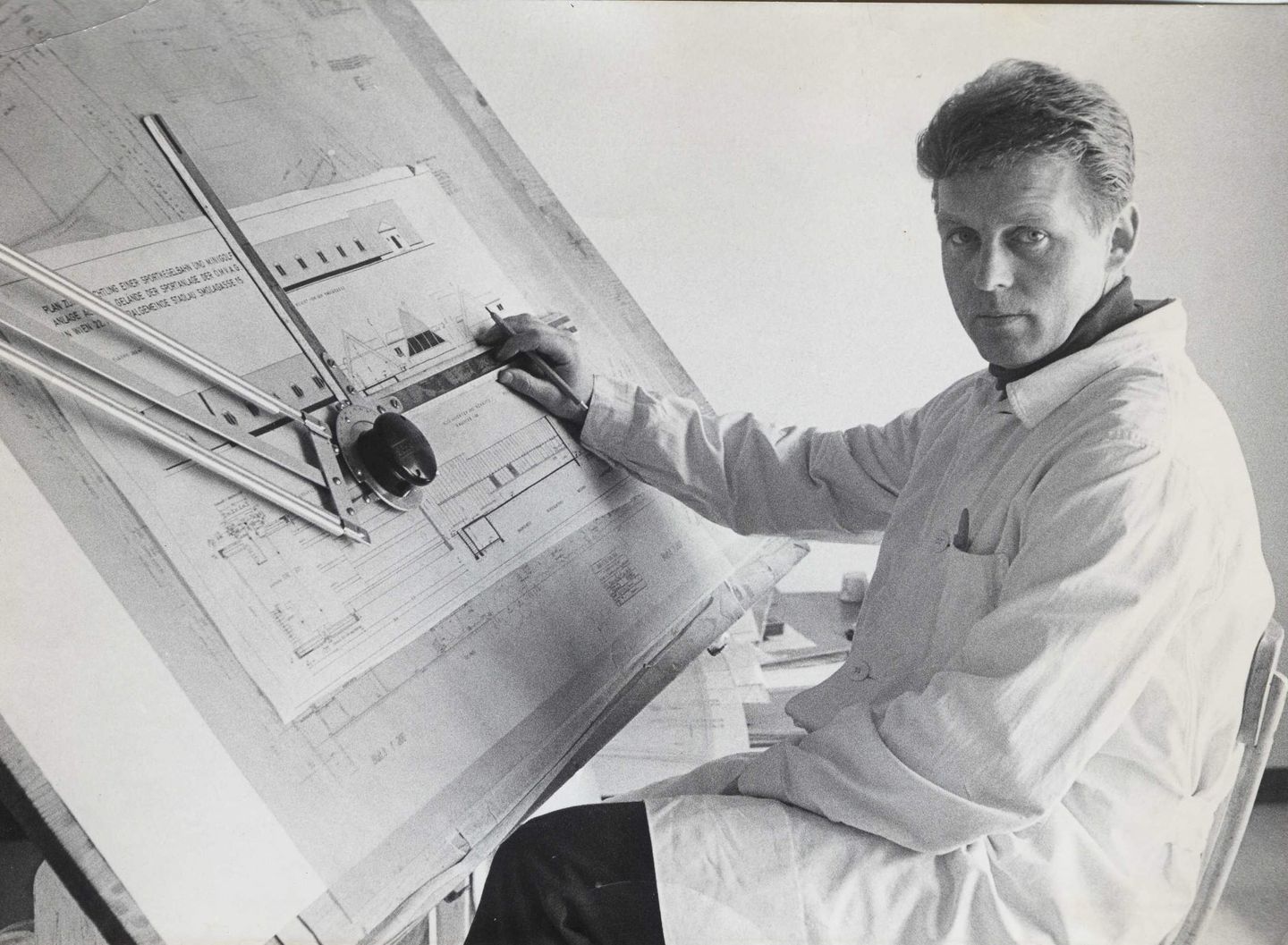
Gerhard Hanappi am Reißbrett, Foto (c) Familienarchiv Hanappi
Gerhard Hanappi am Reißbrett, Foto (c) Familienarchiv Hanappi
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 39 / Juni 2016
93 Länderspiele, Nationalteamkapitän von 1955 bis 1962, WM-Dritter mit dem österreichischen Team 1954 in der Schweiz, 382 Pflichtspiel-Einsätze mit 119 Toren für den SK Rapid Wien, Kapitän dieser Mannschaft von 1957 bis 1964, insgesamt achtfacher österreichischer Meister (einmal mit Wacker, siebenmal mit Rapid), dazu noch zwei Cupsiege und große internationale Erfolge auf Vereinsebene – die sportlichen Erfolge des Supertalents aus Meidling sind bis heute unerreicht.
Und sie werden es angesichts der heute herrschenden Bedingungen (TV-Gelder, Champions League, astronomische Gehalts- und Transfersummen), die es für kleine Länder unmöglich machen, auf Vereinseben international ernsthaft mitzuspielen, für einen Fußballer, der seine gesamte Vereinskarriere in Österreich verbringt, auch bleiben. Dass dieser Ausnahmefußballer neben seiner sportlichen Karriere auch noch ein komplexes und zeitintensives Studium an der TU Wien abschließen und nach der sportlichen Karriere als Architekt sofort Fuß fassen konnte, erscheint heute kaum vorstellbar. Es gibt zwar immer wieder Fußballprofis, die – meist im Herbst ihrer Karriere – ein Fernstudium beginnen, Hanappi schaffte es aber parallel zu seiner besten Zeit als Fußballer.
Diese ungewöhnliche Doppelbegabung zeigte sich schon in jungen Jahren, als der damals 18jährige in seinem Maturajahr mit seinem Meidlinger Stammverein Wacker Wien sensationell das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen hatte – wobei das Cupfinale am 29. Juni 1947, also unmittelbar vor der Matura an der Staatsgewerbeschule in Mödling Anfang Juli, angesetzt war. Im Sommersemester 1948 inskribierte er dann als außerordentlicher Hörer an der Architekturfakultät der TH in Wien.
Prüfungen legte Gerhard Hanappi in diesem „ersten“ Studium keine ab. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme ergab sich dann im Sommer 1950: Der junge Star wollte von Wacker zu Rapid wechseln und meldete sich vom Stammverein ab. Die Vereine konnten sich aber nicht einigen. Das hatte für ihn die unangenehme Folge, dass eine automatische Sperre in Kraft trat. Hanappi inskribierte, dieses Mal als ordentlicher Hörer, erneut an der TH in Wien und setzte das Studium auch fort, als sich Wacker und Rapid im Winter 1950/51 doch noch auf eine Ablösesumme einigen konnten und er wieder spielen durfte.
Nun begann die erstaunlichste Phase in den beiden Karrieren des Gerhard Hanappi. Blickt man auf die Prüfungsdaten und seine Karriere, so fällt zwar auf, dass die Prüfungstermine zunächst zum Großteil in den Sommer- oder Wintermonaten liegen. 1953, das Jahr, in dem er die I. Staatsprüfung ablegte, stand er in der FIFA-Weltauswahl, die in London gegen England ein 4:4 erkämpfte. 1955 erhielt er als letzter Fußballer für mehr als 40 Jahre die Auszeichnung „Österreichischer Sportler des Jahres“ und legte eine Vielzahl von Prüfungen ab.
Unglaublich dann der Schlussspurt im Jahr 1957. Von April bis Juni 1957 absolviert Gerhard Hanappi nicht weniger als 12 Prüfungen mit einem Gesamtausmaß von ca. 80 Wochenstunden. In diesem Zeitraum fehlte er bei keinem einzigen der elf Meisterschaftsspiele des SK Rapid, der in diesem Jahr auch wieder Meister wurde. Am 2. Juli 1957 legte Gerhard Hanappi schließlich die II. Staatsprüfung aus Architektur mit „gutem Erfolg“ ab – sozusagen standesgemäß zwischen Mitropacup-Spielen gegen MTK-Budapest (am 30.6. in Wien und am 6.7. in Budapest)!
Kein Wunder, dass Dipl. Ing. Gerhard Hanappi bei Beendigung seiner Fußballkarriere 1965 ohne Probleme in ein neues Berufsfeld wechselte. Einen Spaziergang zu seinen Bauten, die eben nicht nur aus dem Weststadion, später Gerhard Hanappi-Stadion (nach einem Sager von Pepi Hickersberger zu „Sankt Hanappi“ mutiert) bestehen, bietet die höchst empfehlenswerte Mai-Nummer des Fußballmagazins „Ballesterer“ (Kurzfassung: Ein Gschropp seiner Zeit, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster), die Gerhard Hanappi gewidmet ist und auch ein höchst lesenswertes Interview mit seinen Söhnen Hardy und Michael im Programm hat. Ersterer hat ebenfalls an unserer Universität studiert und ist heute Professor am Institut für Wirtschaftsmathematik.
Gerhard Hanappi (Spitzname „Gschropp“), der auch auf dem Feld praktisch überall außer als Tormann (mit 1,69 war er um einen cm kleiner als Lionel Messi) eingesetzt werden konnte, war ein „Allrounder“ im besten Sinn. Er war aber nicht der einzige spätere Akademiker in der erfolgreichen WM-Mannschaft des Jahres 1954: Walter Schleger vom Erzrivalen Austria Wien studierte an der Veterinärmedizinischen Hochschule, wurde dort Professor und amtierte 1983-1985 sogar als Rektor dieser Universität. Aber damit wären wir schon bei einer neuen Geschichte…
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien

Gerhard Hanappi am Reißbrett, Foto (c) Familienarchiv Hanappi
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 38 / April 2016
2016 jährten sich nicht nur die Todestage von Marie von Ebner-Eschenbach und Kaiser Franz Joseph zum 100. Mal, sondern auch der des Eisenbahnpioniers Karl Gölsdorf.
Am 8. Juni 1861 in Wien geboren, bekam er durch seinen Vater, den Lokomotivkonstrukteur und späteren Maschinendirektor der k.k. Südbahn, Louis Adolf Gölsdorf, schon früh Einblicke in den Lokomotivbau. Bereits während seiner Schulzeit in der Wiedner Oberrealschule fertigte er technische Zeichnungen an. Im Studienjahr 1880/81 inskribierte er an der k.k. Technischen Hochschule (TH) Wien Maschinenbau und absolvierte sein Studium in den vorgegebenen vier Jahren, also quasi in Mindeststudiendauer. Im letzten Jahr belegte er – wie im Studienplan vorgesehen – Vorlesungen zum Eisenbahnbau bei Franz von Rziha. Am 22. Dezember 1884 legte Karl Gölsdorf die Zweite Staatsprüfung mit Auszeichnung ab, beendete damit seine Studien an der TH Wien, und begann seine Tätigkeit in der Maschinenfabrik der österr.-ungar. Staatseisenbahngesellschaft.
1891 wechselte er zu den k.k. Österreichischen Staatsbahnen (kkStB), wo er bereits zwei Jahre später Chefkonstrukteur wurde. Zahlreiche Adaptierungen und Verbesserungen für Lokomotiven gingen auf sein Konto. Eine, für die er sogar über die Grenzen der Habsburger-Monarchie hinaus Bekanntheit erlangte, war die Erfindung der seitenverschiebbaren Kuppelachse für Dampflokomotiven. Diese ermöglichte auch besonders schweren und langen Lokomotiven eine Fahrt auf kurvigen Strecken. Anstatt eines drehbaren Gestells für die Räder bestand Gölsdorfs Lösung in einem starren Rahmen, in dem sich bestimmte Achsen in der Kurve seitlich verschieben konnten. Die erste Dampflokomotive mit eingebauter „Gölsdorf-Achse“ war die Baureihe 170 der kkStB. 1897 erstmals in Betrieb genommen, wurde sie fast 800 Mal produziert.
Im Rahmen seiner Tätigkeiten zeichnete Gölsdorf für die Konstruktion von über 25 Lokomotivtypen verantwortlich, darunter die Baureihe kkStB 310, eine Schnellzugsdampflok, die für den Betrieb auf der Nord-, der Franz-Josefs- und der Westbahn hergestellt wurde und heute noch im Eisenbahnmuseum Strasshof zu bewundern ist.
Gölsdorf war aber nicht nur ein „Praktiker“, er verfasste als Mitherausgeber der Zeitschrift „Eisenbahntechnik der Gegenwart“ einige Aufsätze zur Lokomotivkonstruktion und arbeitete an der „Enzyklopädie des Eisenbahnwesens“ sowie an der „Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie“ mit – beides Standardwerke des Eisenbahnwesens.
In den letzten Jahren vor seinem Tod war Gölsdorf als Mitglied der Kommission für die Abhaltung der Zweiten Staatsprüfung aus Maschinenbau (Studienjahr 1911/12 bis 1916) der TH Wien erneut verbunden. Sein plötzlicher Tod am 18. März 1916 beendete die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit mit seiner Hochschule.
Alexandra Wieser, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 37 / Jänner 2016
Vor über 50 Jahren, am 20. Jänner 1966, starb der Maler Herbert Boeckl.
Boeckl war und ist der TU in Wien zweifach verbunden: Einerseits studierte er an der hiesigen Bauschule von 1912 bis 1918 Architektur, andererseits befindet sich sein Werk „Die Welt und der Mensch“ (aus den Jahren 1956 bis 1958) seit 1977 im Hauptgebäude der TU Wien. Sein Schöpfer wurde damit auch zum Namensgeber für einen der wichtigsten Veranstaltungsorte unserer Universität.
Boeckls Vita wurde seitens der TU Wien in einem kurzen Artikel gewürdigt (Hall of Fame: Herbert Boeckl, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster), nun soll hier auf den Boeckl-Fries und den Boeckl-Saal eingegangen werden.
Nach dem UOG 1975 sollte der bisherige Kollegiums-Sitzungssaal für den nun wesentlich vergrößerten Senat und die anderen neu geschaffenen Kollegialorgane adaptiert werden. In diesem Zusammenhang äußerte der damalige Rektor, der renommierte Architekt Prof. Ernst Hiesmayr, 1976 den Wunsch, die Längsfront mit „einer aus dem Nachlaß von Professor Herbert Boeckl stammenden Collage“ zu gestalten. Dieser Plan wurde vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (auch finanziell) unterstützt und so konnte das Kunstwerk für die TU Wien erworben werden.
Am 25. April 1977 wurde die restaurierte Entwurfscollage in Anwesenheit von Bundesministerin Hertha Firnberg der TU Wien feierlich übergeben. Rektor Hiesmayr betonte in seiner Festansprache, dass er sich als Architekt dazu verpflichtet fühle, „auch dem Haupthaus wieder ein entsprechendes Ansehen zu verleihen“. Er verwies auf seine persönlichen Kontakte mit Herbert Boeckl und bezeichnete ihn – neben Fritz Wotruba – als den österreichischen Künstler von europäischem Rang.
Der Boeckl-Fries ist 12 m lang und 2,5 m hoch und deckt damit fast die gesamte Längsseite des Senats-Sitzungssaales ab. Der Fries stellte die Vorlage für den ausgearbeiteten Gobelin „Die Welt und der Mensch“ dar, den Boeckl im Auftrag von Roland Rainer für die Präsidentenloge der Wiener Stadthalle anfertigte. Die Arbeiten am Gobelin nahmen fast vier Jahre (1954–1957) in Anspruch (Näheres zur Entstehungsgeschichte, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster). Das Bildprogramm des Kunstwerks ist gegliedert durch sechs Lebens- bzw. Schicksalsräder, die darum gruppierten Menschen, Tiere oder Fabelwesen symbolisieren unterschiedliche Möglichkeiten des Scheiterns oder Gelingens menschlicher Existenz.
Anhand dieser eindrucksvollen künstlerischen Leistung sollte man aber auch daran erinnern, dass viele TH- bzw. TU-Dropouts in anderen Bereichen bedeutsame Leistungen vollbracht haben. Neben Boeckl, der sein Studium nach Ablegung der I. Staatsprüfung beendet hatte, seien hier die Schriftsteller Hermann Broch und Arthur Koestler oder der Maler Alfons Walde, dessen Geburtstag sich heuer zum 125. Mal jährt, erwähnt.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 36 / November 2015
Seit den 1830er Jahren wurde für das Wiener Polytechnische Institut zunehmend Reformbedarf konstatiert. Kritikpunkte waren die Inhomogenität der Studierenden nach Alter und Vorbildung, die geringen Möglichkeiten zu wissenschaftlicher Spezialisierung, als veraltet empfundene Lehrmethoden und die fehlende Strukturierung des Studiums (es gab weder Curricula noch formale Studienabschlüsse). Dazu kam wachsender Unmut der Professoren über die Belastung mit „sachfremden“ Aufgaben wie etwa der Begutachtung in Privilegien (Patent-) Angelegenheiten und über mangelnde Partizipationsrechte angesichts der Direktorialverfassung des Instituts.
Die Revolution von 1848 brachte mit der Etablierung des Professorenkollegiums als Beratungsgremium neben dem Direktor zwar einen Fortschritt, die immer dringlichere Modernisierung der Organisation blieb aber vorerst aus. Als vorbildlich galt inzwischen das Fachschulprinzip, wie es erstmals 1832 an der Technischen Schule in Karlsruhe realisiert worden war. Hielt das zuständige Ministerium 1850 die Zeit dafür noch nicht für reif, so richtete es 1859 an die Direktion des Polytechnischen Instituts den Auftrag, Vorschläge für eine Reform zu unterbreiten. Doch erst Ende 1863 legte das Professorenkollegium einen Organisationsentwurf vor. Dieser sah unter anderem eine Neugliederung in vier Fachschulen und eine propädeutische „Allgemeine Abteilung“ statt der bisherigen „Technischen und Kommerziellen Abteilung“ vor, sowie eine wesentliche Umgestaltung des Studiums.
Das Ministerium folgte den Vorschlägen der Professoren weitgehend und erließ mit 17. Oktober 1865, also vor 150 Jahren, ein neues Organisationsstatut, das mit dem Studienjahr 1866/67 in Kraft trat. Es sah eine Gliederung in fünf Fachschulen vor, die Leitung des Instituts lag nun beim Professorenkollegium sowie einem jährlich aus seiner Mitte gewählten Rektor. Die Fachschulen erhielten ebenfalls eine kollegiale Leitung mit einem gewählten Vorstand (ab 1872 Dekan). Für die Aufnahme als Hörer war nun in der Regel ein Maturazeugnis vorgeschrieben, für die Fachschulen wurden Studienpläne erlassen, die bis 1872 obligatorisch waren. Statt einer regulären Abschlussprüfung wurde eine fakultative „strenge Prüfung“ eingeführt, die zur Führung des Titels „diplomierter Ingenieur“ berechtigte.
Damit war das Institut auf seine Kernfunktion als höhere technisch-wissenschaftliche Bildungsanstalt reduziert. Die neue Organisationsstruktur sollte in ihren Grundlinien bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Bestand haben. Joseph Neuwirths Einschätzung des „Organisatorischen Statuts“ von 1865 als eine Art „Neugründung“ des Wiener Polytechnischen Instituts erscheint also durchaus berechtigt.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 35 / Juli 2015
Heute ist an den Universitäten das „UG 2002“ als jüngster Meilenstein der österreichischen Universitätsentwicklung allen Angehörigen ein Begriff; auch seine Vorgänger, das UOG 1993 und vor allem das UOG 1975, das mit der Einführung der Mitbestimmung von „Mittelbau“ und Studierenden einen großen – und nicht unumstrittenen – Schritt zur Modernisierung der Hochschulen gesetzt und die Tür zur „Gruppenuniversität“ geöffnet hat, sind im kollektiven Gedächtnis der Academia noch präsent. Aber das Hochschulorganisationsgesetz (HOG) 1955?
Anlass für seine Erlassung vor über 60 Jahren, am 13. Juli 1955, war die außerordentlich unübersichtliche und sachlich zersplitterte Rechtslage im österreichischen Universitäts- und Hochschulrecht in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Nach Kriegsende 1945 war zunächst die 1940 durch Erlass des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung eingeführte reichseinheitliche Organisation der Hochschulen aufgehoben und die Rechtslage für Österreich auf den Stand vom 13. März 1938 zurückgesetzt worden. Dennoch wurde bald Reformbedarf sichtbar, der zunächst durch weitere Einzelgesetze umgesetzt wurde, was die Übersichtlichkeit nicht erhöht hatte. So galten zum Beispiel für Universitäten und Hochschulen weiterhin unterschiedliche Rechtsnormen.
Daher wurde zunächst versucht, den bestehenden Rechtsbestand zusammenzufassen und zu vereinheitlichen. Das Ergebnis war das HOG 1955, das mit dem Studienjahr 1955/56 in Kraft trat.
Seiner Tendenz nach durchaus restaurativ, schrieb es in vieler Hinsicht die Strukturen der alten „Professorenuniversität“ fest, auch wenn es – ähnlich wie beim UG 2002 – durchaus Spielräume für eigenständige Gestaltung durch die Hochschulen gegeben hätte.
Dennoch brachte das HOG 1955 auch einige wichtige Neuerungen, unter anderem:
- Die Gleichstellung von Hochschulen und Universitäten in rechtlicher Hinsicht
- Die Festschreibung der bis dahin niemals gesetzlich geregelten Autonomie der Hochschulen, ebenso wie ihre bedingte Rechtsfähigkeit
- Die Abgrenzung der Kompetenzen der universitären Organe gegeneinander
- Die Definition des Begriffs der „Lehrkanzel“
- Die gesetzliche Verankerung der Österreichischen Rektorenkonferenz
Speziell für die TH in Wien brachte das HOG nicht nur die Zusammenlegung der traditionellen fünf Fakultäten auf drei, sondern auch die endgültige Außerkraftsetzung des Organischen Statuts aus 1875. Damit markiert das HOG 1955 nicht nur das Ende der Nachkriegszeit, sondern in gewisser Hinsicht auch den Abschied vom 19. Jahrhundert.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 34 / April 2015
Die knorrige Erscheinung, das wettergegerbte Gesicht, der fernsehtauglich zelebrierte Südtiroler Dialekt – so wurde Luis Trenker, dessen Todestag sich am 12. April zum 25. Mal jährte, ab den 1960er Jahren im deutschsprachigen Raum zum Fernsehstar.
Trenker hatte bereits zwei Karrieren hinter sich, bevor er vom Fernsehen entdeckt wurde. 1912 begann er an der TH in Wien ein Architekturstudium, wechselte aber nach einem Jahr und der Ablegung einiger Prüfungen an die TH Graz. Nach seiner Entlassung aus dem Kriegsdienst nahm er 1918 sein Studium an der TH in Wien wieder auf, wechselte bald neuerlich nach Graz und legte dort im Juni 1923 die II. Staatsprüfung ab. Danach arbeitete Trenker zunächst in einer Ateliergemeinschaft mit seinem Jugendfreund Clemens Holzmeister als Architekt in Bozen. Gemeinsam planten die beiden Wohn- und Tourismusbauten. Die schwierige politische Lage nach der Machtergreifung der Faschisten in Italien und die ersten Erfolge Trenkers als Schauspieler in Bergfilmen unter der Regie von Arnold Fanck und an der Seite von Leni Riefenstahl beendeten die intensive Zusammenarbeit.
Zu Beginn der Tonfilmzeit gelang Trenker zusätzlich zu seinen schauspielerischen Aktivitäten der Wechsel in das Regiefach. Mit Filmen wie „Der Rebell“ (1932, Regie gemeinsam mit Kurt Bernhardt) erregte er das Interesse und die Sympathie der Nationalsozialisten. So konnte er nach der Machtübernahme der NSDAP seine Karriere unter besseren Bedingungen fortsetzen. Insbesondere „Der verlorene Sohn“ (1934), teilweise in New York gedreht, ist visuell außergewöhnlich und lässt in vielen Einstellungen den gelernten Architekten Trenker erkennen. Trenker drehte zwar keine eindeutigen Propagandafilme, die ideologische Grundierung seiner Filme (Patriotismus, Heroismus, Antiurbanismus) passte aber zum nationalsozialistischen Weltbild.
Einen Knick erlebte diese Karriere 1939/40: In der Frage der Südtirol-Option – die Südtiroler konnten 1939 entscheiden, ob sie im faschistischen Italien bleiben und ihre deutschsprachige Kultur aufgeben oder in ein vom Deutschen Reich erobertes Gebiet (Galizien, Krim, Burgund etc.) auswandern wollten – hielt er sich mit klaren Aussagen zurück und zog sich damit den Hass von Propagandaminister Goebbels zu. Schon in seiner Studienzeit hatte Trenker klare nationale Zuordnungen vermieden. Das zeigt der Umstand, dass er bei der Erstinskription an der TH in Wien 1912 unter Muttersprache „Ladinisch“, bei der Zweitinskription 1918 „Deutsch“ angegeben hatte. Ob Trenkers Haltung in der Optionsfrage, wie von ihm nach 1945 behauptet, eine Widerstandshandlung gewesen ist, sei dahingestellt.
Trenkers Nachkriegsfilme konnten nicht mehr an die Erfolge der Produktionen aus den 1930er Jahren anschließen. Interessant ist jedoch „Flucht in die Dolomiten“ (1956) wegen der Mitwirkung des jungen Pier Paolo Pasolini als Drehbuchautor. Wenig später begann die dritte Karriere des Südtirolers beim Fernsehen: Mit Serien wie „Berge und Geschichten“ (1970-1972) wurden Trenkers Image und Erzähltalent perfekt ausgenützt.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 33 / Jänner 2015
Der Prechtl-Saal ist einer der beliebtesten und vielseitigsten Veranstaltungsräume der TU Wien. Dabei ist es erst 25 Jahre her, dass dieser Raum in seiner heutigen Gestalt zur Verfügung steht. Er hat jedoch eine ziemlich bunte Nutzungsgeschichte.
Mit Fertigstellung des Hauptgebäudes des k.k. polytechnischen Instituts 1818 übersiedelte die Realschule zu St. Anna, die laut Statut Teil der Organisation des Instituts war, aus ihrem bisherigen Domizil in der Inneren Stadt in das neue Haus. Für die beiden Klassen wurden ihr im Erdgeschoß des linken Flügels zwei große Hörsäle zugewiesen.
Als sie 1851 ausgegliedert wurde, konnten die freiwerdenden Räumlichkeiten neu genutzt werden: In direktem Anschluss an die Aula wurde eine Portiersloge eingebaut, es folgte ein Hörsaal sowie vier Dienerwohnungen. 1872 wurden diese ersetzt durch zwei Hörsäle und einige kleinere Professorenzimmer. Ein Eckraum am Ende des linken Flügels diente zur Aufbewahrung von Geräten.
Nach wiederholten Umbauarbeiten wurde um 1900 an der an die Aula angrenzenden Seite eine Portierloge eingebaut. Um 1910 befinden sich im Bereich des späteren Prechtl-Saals außer der Portierloge die Hörsäle I, II und III. Ab etwa 1925 wurden die Hörsäle I und III für andere Zwecke verwendet. Unter anderem wurden dort Büroräumlichkeiten der "Deutschen Studentenschaft", einer Vorläuferin der heutigen Hochschülerschaft, untergebracht.1958 wurde eine Mensa in den ehemaligen Räumen der Studierendenvertretung eingerichtet. Als diese 1987 in das neu errichtete Freihaus übersiedelte, wurden die frei werdenden Räumlichkeiten nach Plänen von Hans Puchhammer baulich saniert und in einen multifunktionalen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum umgewandelt.
1990 erfolgte die Eröffnung des nunmehrigen Prechtl-Saals im Zuge der 175-Jahr-Feiern der TU Wien. Bei der Umgestaltung der Aula des Hauptgebäudes 2009 im Zusammenhang mit der Sanierung des Mittelrisalits wurde schließlich das 1965 an der linken Seite der Aula errichtete Denkmal für die während des Zweiten Weltkriegs gefallenen Angehörigen der TH in Wien entfernt und ein neuer Zugang zum Prechtl-Saal geschaffen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 32 / Oktober 2014
Am 11. November 1965 wurde im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der Technischen Hochschule in Wien in der Aula des Hauptgebäudes eine Büste von Paul Ludwik enthüllt, angefertigt vom akad. Bildhauer Hans Schmidinger. 1966 wurde sie in den neu adaptierten Hörsaal 11 transferiert, der seitdem Ludwiks Namen trägt. Wer aber war Paul Ludwik?
Geboren wurde Ludwik am 15. Januar 1878 in Schlan/Slaný in Böhmen als Sohn des Direktors der Prager Maschinenbau AG, Kamill Ludwik. Von 1896 bis 1900 studierte er an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag Maschinenbau. Nach zweijähriger Praxis in der Firma seines Vaters trat er 1902 als Konstrukteur an der Lehrkanzel für Mechanische Technologie (Prof. Friedrich Kick) in die TH in Wien ein, der er für mehr als 30 Jahre treu bleiben sollte. Er promovierte 1904 zum Dr. techn. und habilitierte sich bereits 1905 für das Fach "Technologische Mechanik".
1912 zum a.o. und 1918 zum o.ö. Professor für Mechanische Technologie und Materialprüfungswesen ernannt, übernahm er 1923 auch die Leitung des Mechanisch-technischen Laboratoriums und der Technischen Versuchsanstalt (heute TVFA) als Nachfolger von Bernhard Kirsch.
Ludwik interessierte sich mehr für die experimentelle Erforschung von mechanischen Werkstoffeigenschaften als für die praktische Materialprüfung. Er gilt als Begründer der "Technologischen Mechanik" als Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit der plastischen Verformung von Metallen durch Biegen, Ziehen und Walzen. Anhand der "Fließkurve" zeigte er Zusammenhänge zwischen Spannung und Verformung bei metallischen Werkstoffen auf.
Er entwickelte die Kegeldruckprobe als Methode der Härteprüfung und forschte zu Ermüdungserscheinungen von Metallen. Später wandte er sich auch esoterischen und naturphilosophischen Themen zu.
Ludwik war in zahlreichen nationalen und internationalen Fachvereinigungen aktiv. Von 1921 bis 1923 amtierte er als Dekan der Maschinenbauschule. Die Wahl zum Rektor der TH in Wien lehnte er jedoch ebenso ab, wie Angebote aus Prag, Graz, Berlin und vom Kaiser Wilhelm-Institut für Metallforschung. Seine wegweisenden wissenschaftlichen Leistungen fanden Anerkennung, unter anderem durch die Verleihung der Wilhelm Exner-Medaille 1929 und der Adolf-Ledebur-Medaille 1930. Bereits 1924 war er als einer der ersten Techniker zum wirklichen Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewählt worden.
Vor 80 Jahren, am 28. Juli 1934, nahm er sich, offenbar unter dem Druck eines langjährigen Leidens, in Wien das Leben. Das Archiv bewahrt einen umfangreichen Nachlass von Paul Ludwik auf.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 31 / Juni 2014
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs an der Technischen Hochschule in Wien
Als der neue Rektor der TH in Wien, Richard Schumann, in seiner Antrittsrede am 7. November 1914 darauf anspielte, wie nahe der Krieg schon den Gelehrtenstuben gerückt war, war die Hochschule tatsächlich eine andere als noch wenige Monate zuvor.
Nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger am 28. Juni 1914 zeigte sich die "offizielle" TH in Wien erschüttert. Rektor Johann Sahulka sandte umgehend ein Kondolenztelegramm an den Kaiser. An den Studentendemonstrationen vor der serbischen Botschaft in der Paulanergasse am 1. und 2. Juli mögen sich auch Hörer der nahen "Technik" beteiligt haben. Am 3. Juli, dem Tag der Einsegnung des Thronfolgerpaares, wurden alle Vorlesungen, Übungen und Prüfungen auf Anordnung des Rektorats ausgesetzt. Um 12:00 Uhr fand eine feierliche Trauersitzung des Professorenkollegiums statt. Danach aber schienen die Dinge an der Hochschule vorerst wieder ihren gewohnten Gang zu nehmen.
Mit der Kriegserklärung Österreichs an Serbien am 28. Juli und der allgemeinen Mobilmachung am 31. Juli begann jedoch eine Phase hektischer Aktivitäten. Auch die Angehörigen der TH in Wien wurden von der allgemeinen Kriegsbegeisterung erfasst. Viele, die (noch) nicht einberufen wurden, meldeten sich freiwillig. In Erinnerung an die Revolution von 1848 gründeten die Studierenden der Wiener Universitäten eine "Akademische Legion", die Freiwillige für den Einsatz an der Westfront koordinieren sollte. Tatsächlich kam es nicht dazu, vielmehr wurden die Hörer aufgefordert, sich zu Hilfsdiensten an der „Heimatfront“ zur Verfügung zu stellen.
Die Mobilmachung war mit beträchtlichem administrativem Zusatzaufwand verbunden: So mussten bereits gezahlte Inskriptionsgebühren zurückgezahlt und bereits überwiesene Gehälter rückgebucht werden, da die Eingerückten nun ihren (deutlich geringeren) Militärsold erhielten. Bereits am 30. Juli rief daher der Rektor zu Spenden für einen Hilfsfonds auf, um daraus den Familien der Diener einen Zuschuss bezahlen zu können.
Ab Oktober durften Angehörige von "Feindstaaten" nicht mehr inskribieren und auch keine Prüfungen mehr ablegen, Ausnahmen mussten durch das Ministerium genehmigt werden. Zahlreiche entsprechende Ansuchen, meist von russischen Juden, waren daher zu begutachten.
Schon Anfang August wurde an der TH in Wien eine "Sanitätswerkstätte" eingerichtet. Mit 14. August wurde die Errichtung eines "Kriegshilfsspitals" genehmigt, das bald große Teile des Karlstraktes im Hauptgebäude einnahm und bis 1916 bestand.
Bis Anfang November 1914 waren ca. 2 500 Hörer (78 Prozent der Inskribierten des Vorjahrs), 55 wissenschaftliche und 34 nichtwissenschaftliche Angehörige der TH in Wien eingerückt oder zu militärischer Verwendung abkommandiert. Der Vorlesungsbetrieb konnte selbst für die wenigen verbliebenen Hörer nur mit Mühe aufrechterhalten werden, sollte aber "aus volkswirtschaftlichen Gründen", wie die Dekane am 1. Oktober 1914 entschieden hatten, nicht ausgesetzt werden. Auch, um den heimkehrenden Hörern nach einem Friedensschluss rasches Weiterstudieren zu ermöglichen. Es sollte noch sehr lange dauern, bis sich diese Erwartung verwirklichen ließ.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 30 / April 2014
Die besonders feierliche Promotion in Anwesenheit des Staatsoberhaupts geht in Österreich bis in das 17. Jahrhundert zurück: Als "Promotio sub auspiciis Imperatoris" war sie zunächst nur Angehörigen des Adels vorbehalten: Ab 1888 konnte sie auf Ansuchen Doktoratsstudenten gewährt werden, die sich durch ausgezeichneten Studienerfolg hervorgetan hatten. Nachdem die technischen Hochschulen in Österreich 1901 das Promotionsrecht erhalten hatten, bemühten sie sich bald ebenfalls um die Zuerkennung dieser Auszeichnung für ihre Doktoren.
Das Professorenkollegium der k.k. TH in Wien versuchte ab 1910 eine gemeinsame Initiative aller technischen Hochschulen zu initiieren. Dies blieb jedoch erfolglos, ebenso wie die wiederholten Anläufe der Rektorenkonferenz der technischen Hochschulen im Laufe des Ersten Weltkriegs.
Nach 1918 wurde die Auszeichnung nicht mehr verliehen, doch schuf die TH in Wien sich selbst 1923 mit der „Guido und Karoline Krafft-Medaille“, die vom Professorenkollegium verliehen wurde, eine eigene Auszeichnung mit ähnlichen Vergabebedingungen. Basis war ein von dem ehemaligen Professor für Land- und Forstwirtschaftslehre gestiftetes Stipendium, das infolge der weitgehenden Entwertung des Stiftungskapitals nach 1918 in die "Krafft-Medaille" umgewandelt wurde.
1952 wurde die Auszeichnung für hervorragende Promovenden, nun als "Promotion Sub Auspiciis Praesidentis rei publicae", in Österreich neuerlich eingeführt. Neben der Ehre, dass die Promotion durch den Präsidenten der Republik erfolgte, erhielten die Promovierten einen eigens gestalteten Ehrenring.
Aufgrund der gesetzlichen Bedingungen (alle vorgeschriebenen Prüfungsgegenstände ab der Matura mussten mit Auszeichnung und innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden) war es allerdings für Absolventen und Absolventinnen technischer Studien fast unmöglich, zur Sub Auspiciis Promotion zugelassen zu werden, da sie dazu – aufgrund der von den Universitäten abweichenden Studienordnungen - bis zu 84 Einzelprüfungen mit Auszeichnung hätten ablegen müssen. Daher intervenierten die Technischen Hochschulen mehrfach, um eine Abänderung des Gesetzes bzw. eine Auslegung des Begriffs „Einzelprüfungen“ zu erreichen, damit auch Promovenden und Promovendinnen aus technischen Studienfächern Chancen auf eine "Sub Auspiciis" Promotion bekamen. Eine authentische Interpretation, dass nämlich Vorprüfungsgegenstände der Staatsprüfungen nicht mitgerechnet werden mussten, erfolgte 1964. Damit konnte am 27. Mai 1964, also vor 50 Jahren, die erste "Promotion Sub Auspiciis Praesidentis" an der damaligen TH in Wien erfolgen. Vergeben wurde sie an den Chemiker Heinrich Till.
Als erste Frau wurde 1984 die Technische Physikerin Helga Ebenberger zur Promotion Sub Auspiciis zugelassen. Insgesamt erfolgten an der TU Wien bis dato 140 solcher besonders feierlichen Promotionen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 29 / Jänner 2014
Vor 100 Jahren, am 3. Februar 1914, wurde es Frauen mittels Ministerialerlasses erlaubt, als außerordentliche Hörerinnen auch an österreichischen technischen Hochschulen zu inskribieren. Der wenig spektakuläre Vorgang illustriert die äußerst zögerliche Haltung der Unterrichtsverwaltung gegenüber dem Frauenstudium und belegt zugleich, dass auch seinerzeit die Bildungspolitik nicht immer sektorübergreifend koordiniert war.
Der Erlass war nämlich letztlich eine Reaktion auf Sachzwänge, die sich aus der Schulpolitik ergaben: In einer Reihe von Verordnungen aus den Jahren 1907, 1911 und 1912, die der Qualitätssicherung der LehrerInnenausbildung dienen sollten, wurde nämlich festgelegt, dass KandidatInnen für das Lehramt an Höheren Handelsschulen sowie für die Fächer Darstellende Geometrie und Freihandzeichnen an Mittelschulen und Mädchenlyzeen die Absolvierung universitärer Fachstudien nachweisen mussten. Diese Lehramtsstudien standen grundsätzlich auch Frauen offen – nur durften sie die ausschließlich an technischen Hochschulen angebotenen Fächer Darstellende Geometrie und Freihandzeichnen dort nicht inskribieren. Sie waren zwar seit 1908 als Gasthörerinnen zugelassen, konnten als solche aber keine Zeugnisse erwerben. Es musste also eine Lösung für die Lehramtskandidatinnen gefunden werden.
In diesem Zusammenhang übernahm die TH in Wien eine Vorreiterrolle. Der Rektor des Jahres 1912/13 und Professor für Darstellende Geometrie, Emil Müller, ergriff selbst die Initiative und richtete noch 1912 ein Schreiben an das Unterrichtsministerium, in dem er auf die widersprüchliche Gesetzeslage hinwies und auch einen Vorschlag für deren Behebung vorlegte. Sein Vorgehen war nicht ganz uneigennützig: Er hatte nämlich eine mathematisch begabte Tochter, die selbst gerne Darstellende Geometrie inskribiert hätte. Nachdem Aurelia Müller und eine Reihe weiterer Kandidatinnen im Frühjahr 1913 ein Gesuch auf Zulassung an die Unterrichtsverwaltung gerichtet hatten, sah man sich dort veranlasst, eine allgemeine Regelung vorzunehmen. Sie erfolgte wiederum so eng wie möglich: Die Zulassung war beschränkt auf jene Fächer, die für ein Lehramt erforderlich waren, alle technischen Fächer blieben weiterhin ausgeschlossen.
Die Zahl der ersten außerordentlichen Hörerinnen war gering: An der TH in Wien waren es von 1913 bis 1919 nur 27 Personen. Dennoch war es ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Technikstudium für Frauen. Es sollte allerdings der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs bedürfen, bis auch die letzten Barrieren abgebaut werden konnten.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 28 / Oktober 2013
Der tragische Lebensweg von Walter Greif, Student und Absolvent des Faches Maschinenbau an der TH in Wien, ist typisch für viele linke AktivistInnen der 1930er und 40er Jahre. Obwohl er sein Studium mit großer Konsequenz und Erfolg vorangetrieben hatte, konnte er nie in seinem Fach tätig werden, hatte als Kommunist und rassisch Verfolgter nie die Option auf ein bürgerliches Leben mit Beruf und Familie.
Walter Greif wurde am 30. Juni 1911 als Kind einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Trotz widriger finanzieller Lebensumstände absolvierte er das Realgymnasium im 8. Bezirk und begann 1930 das Studium des Maschinenbaus an der TH in Wien. Bis zur I. Staatsprüfung kam er rasch und erfolgreich voran: Im März 1933 legte er die I. Staatsprüfung mit sehr gutem Erfolg ab.
Ab 1934 war sein Studium, ja sein gesamtes Leben, von den politischen Kämpfen der Zeit geprägt: Der junge Sozialist, der im Verband sozialistischer Studenten aktiv gewesen war, wandte sich wie viele (vor allem junge) AktivistInnen von der Sozialdemokratie ab und trat in die ebenfalls illegale KPÖ ein. Gleichzeitig trat er aber bereits im März 1934 – ohne seine Gesinnung geändert zu haben – der Einheitspartei "Vaterländische Front" bei. Bei einer kommunistischen Kundgebung auf der Schmelz wurde er im Juli 1934 verhaftet und zu sechs Wochen Arrest verurteilt. An eine sofortige Wiederaufnahme des Studiums war nach der Entlassung aus dem Gefängnis nicht zu denken, da er für das gesamte Studienjahr 1934/35 von allen österreichischen Hochschulen relegiert worden war.
Walter Greif setzte aber alles daran, um sein Studium abschließen zu können: Er stellte 1935 ohne Erfolg Gnadengesuche und nach der Wiederaufnahme 1935/36 vergeblich Anträge auf Studiengeldbefreiung. Trotzdem holte er binnen kurzer Zeit die ausstehenden Prüfungen nach und legte am 8. März 1937 die II. Staatsprüfung ab.
Nur wenige Wochen später, im April 1937, ging Ingenieur Walter Greif nach Spanien, um in die Internationalen Brigaden einzutreten und auf Seite der republikanischen Regierungstruppen gegen die Militärputschisten unter General Franco zu kämpfen. Nachdem sich die Niederlage der Republik abzuzeichnen begann, wurde er Ende 1938 mit seiner Einheit nach Frankreich evakuiert. An eine Rückkehr in die inzwischen nationalsozialistische Heimat war nicht mehr zu denken.
Nach der französischen Niederlage im 2. Weltkrieg schloss er sich 1940, getarnt als elsässischer Arbeiter, der Résistance an. Obwohl als Kommunist und Jude doppelt gefährdet, kehrte der Widerstandskämpfer 1942 als französischer Zivilarbeiter nach Wien zurück. Nach ca. einem Jahr Widerstandstätigkeit in Wien flog die Gruppe auf: Greif, der vor allem Ausweise gefälscht und den Kontakt zwischen KPÖ und KPF koordiniert hatte, seine Lebensgefährtin und weitere Mitstreiter wurden im August 1943 verhaftet und unter Anklage gestellt. Walter Greif wurde nach Auschwitz deportiert und dort, wie Augenzeugen nach dem Krieg berichteten, 1944 ermordet. Seine Lebensgefährtin wurde ebenfalls zum Tode verurteilt und 1945 in Wien hingerichtet.
Für die Aufnahme in das Ehrenbuch der TH in Wien 1965 hat niemand Walter Greif namhaft gemacht.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 27 / Juni 2013
Der 1910 in Wien geborene Ferdinand Habel maturierte 1929 am Marieninstitut in Graz und begann danach mit dem Studium der Elektrotechnik an der TH in Wien. Er stammte aus einer tiefkatholischen Familie, sein gleichnamiger Vater wirkte von 1921-1946 als Domkapellmeister in St. Stephan.
1935 legte Ferdinand Habel jun. die Erste Staatsprüfung mit sehr gutem Erfolg ab. Im Sommer 1938 stand er kurz vor dem Abschluss des zweiten Studienabschnitts, seine letzten Prüfungen datieren aus dem Juli.
Am 7. Oktober 1938 beteiligte sich Habel, der seit 1929 der CV-Verbindung "Babenberg" angehörte, an der Rosenkranzfeier im Wiener Stephansdom, die sich schließlich zur so genannten "Rosenkranz-Demonstration", der einzigen Großdemonstration gegen das NS-Regime auf österreichischem Boden, entwickelte. Ca. 7000 Jugendliche (darunter auch der spätere Psychiater und Univ. Prof. Erwin Ringel und der nachmalige Verleger Fritz Molden) provozierten die Nazis mit Slogans wie "Es lebe Christus, unser König!" und ließen Kardinal Innitzer hochleben, der den "Anschluß" zunächst begrüßt hatte, dann aber bald feststellen musste, dass auch die Kirche von den Nazis immer weiter durch Vereinsauflösungen und Presseverbote eingeschränkt wurde. Die Behörden waren von dieser Kundgebung sichtlich überrascht und griffen nicht sofort ein. Nach der polizeilichen Auflösung der Kundgebung wurde der auf dem Heimweg befindliche Ferdinand Habel mit einigen anderen katholischen Aktivisten verhaftet. Nach einer Intervention des Apostolischen Nuntius wurden alle schon am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.
Am Tag nach der Rosenkranz-Demonstration verwüsteten Trupps der Hitler-Jugend mit Duldung der Polizei das erzbischöfliche Palais. Habel, der in unmittelbarer Nähe des Stephansplatzes wohnte, geriet am 10. Oktober in einen Wortwechsel mit Passanten und wurde an Ort und Stelle verhaftet. Zwei Monate blieb er in Polizeihaft. Danach wurde er im Dezember 1938 zusammen mit den anderen so genannten "Innitzer-Gardisten" (dies war ursprünglich ein Spottname der SS für die nach der Rosenkranz-Demonstration Verhafteten, wurde aber nach dem Krieg von den überlebenden Widerstandskämpfern selbst für ihre Gruppe verwendet) nach Dachau deportiert. Von hier wurden die Mitglieder der Gruppe im September 1939 nach Mauthausen überstellt, wo Habel, wie sein Freund und Mitstreiter Hermann Lein (1920-2006) berichtete, im Februar 1940 verhungerte.
Im anlässlich des Jubiläumsjahres 1965 von der TH in Wien angelegten "Ehrenbuch der Gefallenen und Opfer des 2. Weltkriegs" ist Ferdinand Habels Name der einzige, der in der Rubrik "Opfer des Widerstands" aufscheint. Nachträglich wurde der Name des TH-Absolventen Dipl. Ing. Alfred Miegl, der als führendes Mitglied der katholischen "Österreichischen Freiheitsbewegung" im Mai 1944 hingerichtet wurde, ergänzt.
Nicht vermerkt sind in diesem "Ehrenbuch" übrigens die Namen der jüdischen Opfer der Shoah und des Widerstands.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 26 / April 2013
Als am 25. April 1938 an der Wiener Technik der Unterrichtsbetrieb für das Sommersemester nach sechswöchiger Sperre wieder aufgenommen wurde, war nichts mehr so wie zuvor – nicht an der TH in Wien und nicht in Österreich.
Ab Freitag dem 11. März hatte das Unterrichtsministerium angeordnet, die Vorlesungen wegen der "politischen Hochspannung" auszusetzen. Von da an überschlugen sich die Ereignisse. Die für den folgenden Tag vorgesehene öffentliche Abstimmung der Beamten zugunsten eines freien Österreich konnte nicht mehr abgehalten werden, da nach dem Rücktritt Kurt von Schuschniggs der Nationalsozialist Arthur Seyss-Inquart als Bundeskanzler installiert wurde – Hitler war bereits in Linz. Am 13. März proklamierte er den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, am 14. März war er in Wien.
Noch am 13. März gab das Professorenkollegium (PK) der TH in Wien unter Rektor Karl Holey seine "freudige Genugtuung" über diese "Neugestaltung" kund. Am 14. März traten Holey und Prorektor Friedrich Böck zurück (beide wurden politisch dem "Ständestaat" zugeordnet), Prof. Rudolf Saliger wurde vom PK "kommissarisch" zum Rektor und Prof. Friedrich Schaffernak zum Prorektor gewählt. Bereits am 17. März konnte Saliger mitteilen, dass inzwischen auch der Dekan Karl Wolf (Bauingenieurwesen) und der Leiter der Rektoratskanzlei, Josef Goldberg, zurückgetreten waren, beide aus "rassischen" Gründen. Sie wurden vorläufig durch die Professoren Theodor Dokulil und Roman Grengg vertreten. Auch der einzige jüdische o. Professor der Hochschule, Emil Abel, hatte bereits um seine Beurlaubung angesucht. Neu im "Leitungsteam" der TH waren NS-Dozentenbundführer PD Herbert Schober und NS-Studentenführer Ernst Müller als Repräsentanten der NSDAP. Am 4. April wurde der Dekan der Chemisch-Technischen Fakultät, Wolf Johannes Müller, durch Prof. Josef Weese ersetzt.
Die für den 21. März geplante Wiederaufnahme des Unterrichts wurde wegen der Vorbereitungen zur "Volksabstimmung" vom 10. April auf den 25. April verschoben. Am 22. März fand die öffentliche Vereidigung aller Hochschulangehörigen auf den "Führer" statt – "rassisch" und politisch missliebigen Personen war das nicht erlaubt. Sie wurden aufgefordert, um ihre Beurlaubung anzusuchen.
Bis zum Herbst 1938 wurden 9 Professoren, 2 Assistenten und 4 Angehörige des sonstigen Personals beurlaubt bzw. in den Ruhestand versetzt, 17 Personen wurde die Lehrbefugnis entzogen oder ruhend gestellt. Die personellen Säuberungen zogen sich jedoch noch bis weit in das Jahr 1939 hin. Ein Erlass vom 23. April verordnete für jüdische HörerInnen eine Höchstquote von 2%, die an der TH in Wien schon im Sommersemester 1938 mit 1,3% deutlich unterschritten wurde.
Bei der feierlichen Wiedereröffnung der Technik am 25. April, in der gleichzeitig des "Führergeburtstags" gedacht wurde, konnte der Rektor somit eine weitgehend nazifizierte Hochschule präsentieren. Die hochfliegenden Erwartungen, die mit der "neuen Zeit" verbunden wurden, sollten allerdings bald herb enttäuscht werden.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 25 / Jänner 2013
Zu den heute nur wenig bekannten ehemaligen Hörern des Wiener Polytechnischen Instituts gehört der Techniker, Schriftsteller und Sozialreformer Josef Popper, der sich später "Lynkeus" (Türmer) nannte.
Vor 175 Jahren, am 21. Februar 1838, wurde der begabte Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Kolin/Böhmen geboren. 1854–1857 studierte er am Polytechnikum in Prag, 1857–1859 am polytechnischen Institut in Wien. Da er als Jude aufgrund des Konkordats von 1855 eine ihm angebotene Assistentenstelle nicht annehmen durfte, arbeitete er ab 1859 zunächst als Eisenbahn-Angestellter.
1862 ging er nach Wien, wo er sich als Schriftsteller durchschlug, bis er 1865 eine Hauslehrer-Stelle erlangte. Zugleich hörte er an der Universität Wien naturwissenschaftliche und philosophische Vorlesungen. Aus dieser Zeit datiert seine Bekanntschaft mit dem Physiker und Philosophen Ernst Mach. Ende der 1860er Jahre gründete er mit seinem Bruder David eine Firma zur Verwertung seiner zahlreichen Erfindungen (u.a. ein Dampfkessel-Reiniger 1867, ein Oberflächenkondensator 1889 und ein Luftkühlapparat 1891). Daneben publizierte er zahlreiche Abhandlungen zu Themen der Maschinen- und Elektrotechnik und der Flugtechnik. Bereits 1862 war im Almanach der Akademie der Wissenschaften seine Abhandlung "Über die Nutzung der Naturkräfte" erschienen, in der er erstmals die Idee der elektrischen Kraftübertragung entwickelte. Seine erfolgreichste Publikation waren die "Phantasien eines Realisten" (1899), in denen er die Freudsche Theorie der Traumzensur vorweg nahm.
Seit Ende der 1870er Jahre wandte Popper sich verstärkt sozialreformerischen Fragen zu. In seinem Werk über die "Allgemeine Nährpflicht" (1912) forderte er ein staatliches Grundeinkommen, gekoppelt an eine allgemeine Sozialdienstpflicht. Er plädierte gegen die Wehrpflicht und für eine Strafrechtsreform, wandte sich gegen die antisemitischen Strömungen seiner Zeit und vertrat er die Idee eines eigenen jüdischen Staates.
Seine Schriften wurden vor allem im und nach dem I. Weltkrieg breit rezipiert, u.a. von Sozialisten wie Otto Bauer, Rudolf Goldscheid oder Otto Neurath, die über eine Reform der durch den Krieg erschütterten Gesellschaft nachdachten.
Josef Popper, ein weitläufiger Verwandter des Philosophen Karl Popper, starb am 22. Dezember 1921 in Wien. Sein 1926 im Rathauspark errichtetes Denkmal wurde 1938 von den Nationalsozialisten zerstört und 1951 erneuert.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 24 / Oktober 2012
Als 1810 der Direktor der k.k. Realakademie, Johann Joseph Prechtl, mit dem Entwurf eines Organisationsplans für ein polytechnisches Institut in Wien beauftragt wurde, gab es dazu schon eine längere Vorgeschichte.
Erste Überlegungen zur Errichtung eines "technologischen Instituts" in Wien gehen bis in das Jahr 1803 zurück. Zu den wichtigsten Betreibern gehörten, neben Kaiser Franz I. (II.) als Initiator, die k.k. Studienhofkommission als Unterrichtsbehörde, die k.k. Hofkammer als Behörde für das Wirtschafts- und Finanzwesen der Monarchie, und die k.k. nö. Landesregierung. Zunächst dachte man an eine Anlagerung an die Wiener Universität, wo es bereits eine technologische Lehrkanzel gab. So wurde 1803 der Professor der Arzneikunde und Chemie Johann Nepomuk Jassnüger mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragt. Sein 1806 vorgelegter Entwurf, der stark in Richtung einer landwirtschaftlichen Schule ging, wurde den Behörden zur Begutachtung übermittelt. Diese legte auch selbst Vorschläge vor, kam aber bis 1809 zu keiner endgültigen Meinungsbildung.
Prechtls Auftrag war daher ein Neuansatz. Am 23.10.1812 wurde sein Entwurf dem Kaiser vorgelegt. Er sah drei "Sektionen" vor, eine "chemisch-technische", eine "mathematisch-technische", und eine "empirisch-technische"; ebenso die Anlage von Lehr- und Forschungssammlungen. Außerdem sollte die neue Institution Aufgaben der Behörden- und der Kundenberatung in technologischen und gewerblichen Fragen wahrnehmen.
Dieser Plan, der schon wesentliche Grundzüge der späteren Verfassung des k.k. Polytechnischen Instituts enthielt, wurde neuerlich begutachtet, auch durch den Direktor des 1806 errichteten Prager polytechnischen Instituts, Franz Joseph Gerstner als ausgewiesenem Experten. Dessen 1813 vorgelegte, sehr kritische Stellungnahme wurde von Prechtl noch im selben Jahr ausführlich widerlegt; dennoch zog sich der Prozess über etliche Jahre hin (auch, weil sich Studienhofkommission und Hofkammer nicht über ihre Rolle in Bezug auf das neue Institut einigen konnten). Erst am 24.7.1816 konnte dem Kaiser ein Entwurf vorgelegt werden, der gegenüber 1812 eine Reihe wesentlicher Änderungen enthielt (statt der drei wissenschaftlichen "Sektionen" gab es eine Technische und eine Kommerzielle Abteilung, außerdem wurde dem Institut eine Realschule zur Vorbereitung angegliedert). Mit 31.8.1817 erhielt er die endgültige Genehmigung des Kaisers – fast zwei Jahre, nachdem das Institut seinen Lehrbetrieb aufgenommen hatte.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 23 / Juni 2012
Vor 50 Jahren verstarb mit Maximilian Fabiani ein wichtiger Vertreter der frühen Moderne der Wiener Architektur. Zu seinen schönsten und populärsten Bauten gehört die Wiener Urania, die in den Jahren 1909/10 errichtet wurde.
Dreisprachig (deutsch, slowenisch, italienisch) aufgewachsen, inskribierte der aus dem Hinterland von Triest stammende Fabiani nach Absolvierung der Realschule in Ljubljana/Laibach 1883/84 an der Bauschule der Technischen Hochschule (TH) in Wien. Dass seine nationale Identität im Wandel begriffen war, zeigt der Umstand, dass er in den ersten Studienjahren "slowenisch", ab dem Studienjahr 1888/89 aber "italienisch" als Muttersprache angab.
1892 legte er die "Strenge Prüfung" ab, eine besonders aufwendige Abschlussprüfung, die von 1872 bis zur Erteilung des Promotionsrechts (1901) angeboten wurde, der sich aber nur wenige Studierende unterzogen. Danach begab sich der "diplomierte Architekt", so der Titel der mit der Ablegung der Prüfung verbunden war, mit einem Ghega-Stipendium auf eine zweijährige Studienreise durch Europa.
Nach der Rückkehr nach Wien im Jahr 1894 arbeitete Fabiani zunächst im Atelier von Otto Wagner und ab 1896 als Assistent und Konstrukteur an der Lehrkanzel für Baukunst an der TH in Wien. Er war der erste Architekt, der 1902 das Doktorat der technischen Wissenschaften an unserer Universität erwarb.
Neben der Lehrtätigkeit entstanden in Wien, in Ljubljana/Laibach, Trieste/Trst/Triest und anderen Orten eine Reihe von Bauten nach Plänen Fabianis. Auch als Stadtplaner und Publizist trat er immer wieder an die Öffentlichkeit.
1910 wurde Fabiani zum außerordentlichen Professor, 1917 schließlich zum ordentlichen Professor der Baukunst an der TH in Wien ernannt. Im Jänner 1918 wurde Fabiani vom Ministerium für öffentliche Arbeiten mit der Leitung des Wiederaufbaus der vom Krieg stark zerstörten Stadt Goricia/Gorica/Görz betraut. Seine Lehrveranstaltungen an der TH mussten suppliert werden. Nach dem Waffenstillstand im November 1918 fiel diese Stadt an Italien. Trotz der Aufforderung nach Wien zurückzukehren, setzte Fabiani seine Aufbauarbeit fort und "optierte" auf diese Weise für Italien. Deshalb wurde er im Dezember 1918 vom Dienst enthoben.
Fabianis Karriere als Architekt und Hochschullehrer wurde durch die politischen Umbrüche schwer beeinträchtigt, als Stadtplaner und Raumordner blieb er aber weiter aktiv. 1952 kehrte der 87jährige Fabiani noch einmal an die TH zurück, und zwar anlässlich der Verleihung des Goldenen Doktordiploms.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 22 / April 2012
Ende 2011 hat das Archiv der TU Wien den Teilnachlass eines Absolventen der TH in Wien, des Architekten Otto Kollisch (1881–1951) erhalten. Die Unterlagen – Lebensdokumente, Korrespondenzen sowie eine Reihe von Werkfotos – wurden dem Archiv von seinen Kindern, Eva und Peter Kollisch, geschenkt.
Das schmale Konvolut erlaubt trotz seines geringen Umfangs einen Einblick in das Schicksal eines jüdischen Absolventen unserer Hochschule, das in vieler Hinsicht repräsentativ ist für Angehörige seiner Generation.
Geboren 1881 in Wien als Sohn eines Goldschmieds, studierte Otto Kollisch 1899 – 1905 an der TH in Wien Architektur, unter anderem bei Carl König. 1907 legte er die II. Staatsprüfung ab und erwarb danach Praxiserfahrung in verschiedenen Wiener Architektenbüros. 1912 machte er sich als Architekt selbständig. Er beteiligte sich an mehreren Architektenwettbewerben und baute einige Wohnhäuser in Wien. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 wurde er einberufen und leistete Kriegsdienst als Architekt für militärische Bauprojekte. Er wurde mehrfach ausgezeichnet. Nach dem Krieg gründete er 1920 mit zwei Gesellschaftern die OKA Gesellschaft für Bau- und Industriebedarf, deren Geschäftsführer er bis 1937 war. Daneben arbeitete er auch als Architekt und errichtete unter anderem 1930/31 eine Wohnanlage in Wien XII., Kernstraße 11.
1923 heiratete er die Lyrikerin Margarethe Moller, ab 1928 lebte er mit seiner Familie in Baden bei Wien. Der Einmarsch der Nationalsozialisten 1938 machte eine weitere berufliche Existenz in Österreich unmöglich. 1939 gelang es ihm mit seiner Frau und drei Kindern über London nach New York zu emigrieren. Dort musste er seine Familie zunächst als Vertreter über Wasser halten, bis er 1940 seine Zulassung als Architekt erhielt. In der Folge baute er eine Reihe von Wohnhäusern auf Staten Island, NY. Er starb Anfang 1951 in New York.
Seine Tochter, die Schriftstellerin Eva Kollisch, hat ihre Erfahrungen in der Emigration in mehreren Werken verarbeitet. Sie erhält im Mai 2012 in Wien den Theodor Kramer-Preis für das Schreiben im Widerstand und Exil.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 21 / Jänner 2012
Am 11. Jänner 1862, also vor 150 Jahren, wurde in Beraun bei Prag Friedrich Ignaz Edler von Emperger geboren. Der Sohn eines Direktors der Aussig-Teplitzer Eisenbahn studierte Bauingenieurwesen an der Deutschen TH in Prag (DTH Prag), 1881/82 auch an der TH in Wien, und legte 1885 die II. Staatsprüfung ab. Nach einer kurzen Tätigkeit als Assistent an der Lehrkanzel für Brücken- und Eisenbetonbau an der DTH Prag arbeitete er bei verschiedenen Baufirmen in Böhmen. 1889 lernte er bei einem Besuch der Pariser Weltausstellung die damals neue Stahlbetonbauweise kennen und erkannte ihr zukunftsweisendes Potenzial.
1891 ging Emperger in die USA, wo er den Eisenbetonbau einführte und bei zahlreichen Hochhäusern, Brücken und Industriebauten realisierte. So zeichnete er unter anderem für Entwurf und Ausführung der ersten U-Bahnen in New York und Boston verantwortlich. Auch die erste Eisenbetonbrücke in Stockbridge, Massachusetts, wurde von ihm erbaut. Zeitweise unterhielt er ein eigenes Ingenieurbüro in New York.
1896 kehrte er aus privaten Gründen nach Österreich zurück, wo er seine in den USA gewonnenen Erfahrungen mit der neuen Bauweise zu verbreiten suchte. 1901 gründete er die Zeitschrift "Beton und Eisen" (heute: "Beton- und Stahlbetonbau"), die lange als das führende Organ für diese Technologie galt. 1908/09 gab er das erste "Handbuch für Eisenbetonbau" heraus. 1898–1902 lehrte Emperger als Honorardozent an der TH in Wien "Enzyklopädie der Ingenieurwissenschaften". 1903 promovierte er an der DTH Prag zum Dr. techn. 1908 wurde er zum Oberbaurat ernannt.
Emperger war seit 1899 Mitglied des Österreichischen Patentamts und von 1926–1938 Präsident des von ihm gegründeten österreichischen Eisenbetonausschusses. Zahlreiche in- und ausländische Ehrungen wurden ihm zuteil, so unter anderem Ehrendoktorate der DTH Prag und der TH Dresden sowie die Ehrenmitgliedschaft des American Institute of Civil Engineers und des Institute of Structural Engineers in London. Eine zu seinem 80. Geburtstag angeregte Verleihung des Professorentitels scheiterte jedoch, unter anderem am massiven Widerstand seines etwas jüngeren Fachkollegen Rudolf Saliger, mit dem er sich heftige fachliche Auseinandersetzungen geliefert hatte.
Friedrich von Emperger starb kurz nach seinem 80.Geburtstag am 2. Februar 1942 in Wien.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 20 / Oktober 2011
„Es ist durchaus keine Übertreibung, wenn man die Lage der Hochschulen in Österreich als tragisch bezeichnet und sachlich feststellt, dass die Tragik sich von Jahr zu Jahr vertieft.“ Derart deutliche Worte fand die Österreichische Rektorenkonferenz (ÖRK) im April 1961 in einer an der TH in Wien beschlossenen Resolution. Das Land drohe wegen fehlender Investitionen in die Bildung zu „einem Museum großer Vergangenheit“ zu werden.
Als kurz darauf bekannt wurde, dass das Budget ausgerechnet über die Kürzung des Unterrichts- und Kulturetats saniert werden sollte, verlangte die ÖH von der Bundesregierung die Rücknahme dieser Pläne. Die Regierung ging – trotz der Rücktrittsdrohung von Unterrichtsminister Drimmel – nicht darauf ein, und so kam das universitäre Leben in Österreich für eine ganze Woche, vom 29.5. bis zum 3.6., zum Erliegen. Auch die Professoren unterstützten den Streik.
In Wien führte ein Demonstrationszug am 29.5.1961 von der Universität über den Ring zur Technischen Hochschule, wo eine Abschlusskundgebung angesetzt war. Die Transparente trugen Slogans wie „In diesen Labors wäre nicht einmal das Schieszpulver erfunden worden“, „Hochschulen – Armenhäuser von heute“ oder „Defizit durch Dummheit“. Ein Sitzstreik auf der Opernkreuzung führte zu einem gewaltigen Verkehrschaos, in dem auch der Konvoi des auf Staatsbesuch in Wien weilenden finnischen Präsidenten Kekkonen steckenblieb. Bei den Auseinandersetzungen wurden vier Polizisten verletzt.
An der Kundgebung im Resselpark nahmen 3000 TeilnehmerInnen teil. Unter den Rednern war auch Heinrich Sequenz. Der letzte Rektor der TH in Wien in der NS-Zeit, 1945 seines Amtes enthoben und 1954 als ordentlicher Professor an die TH zurückgekehrt, geißelte in seiner Ansprache insbesondere die erschreckenden Zustände in den Hörsälen und Laboratorien. Dass ein Redner wie Sequenz bei einem solchen Anlass fehl am Platze war, kam weder den Initiatoren der Kundgebung noch den journalistischen Beobachtern in den Sinn.
Die Anliegen der Demonstranten wurden von der öffentlichen Meinung weitgehend unterstützt. So meinte etwa Hugo Portisch am 31.5. im „Kurier“: „Eine demokratisch aktive Jugend sollte das Herz jedes Politikers höher schlagen lassen.“ Der Hochschulstreik 1961 war teilweise erfolgreich: Immerhin konnten weitere Budgetkürzungen verhindert werden.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 19 / Juni 2011
Emil Müller, geboren vor 150 Jahren am 22.4.1861 in Landskron/Böhmen, gilt als bedeutendster Vertreter der „Wiener Schule der Darstellenden Geometrie“. Nach Studien an der Allgemeinen Abteilung der TH in Wien und an der Universität Wien legte er 1885 die Lehramtsprüfung aus Mathematik und Darstellender Geometrie ab. 1886–1890 war er Assistent an der TH in Wien bei Rudolf Staudigl und ging 1892 als Oberlehrer an die neue Baugewerkenschule in Königsberg. Dort fand er neben seiner Lehrtätigkeit auch Zeit für wissenschaftliche Forschung und Kontakt zu bedeutenden Mathematikern, die damals an der Universität Königsberg lehrten. 1898 promovierte er dort bei Franz Meyer zum Dr. phil., 1899 wurde ihm die Lehrbefugnis für Geometrie und Mechanik verliehen.
1902 kehrte er als Nachfolger Staudigls als Professor für Darstellende Geometrie (DG) an die TH in Wien zurück. Hier verbesserte er den Unterricht in DG für Architekten und Bauingenieure und machte sich besonders um die vorbildliche Ausgestaltung der Lehramtsausbildung verdient. Er erreichte 1913 die Zulassung von Frauen als außerordentliche Hörerinnen für die Lehramtsfächer an technischen Hochschulen, angeregt durch den Studienwunsch seiner Tochter Aurelia.
Wissenschaftlich entwickelte er insbesondere die Ausdehnungslehre von H. Grassmann weiter, die er in Königsberg kennen gelernt hatte. 1903 gehörte er zu den Mitbegründern der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft.
Müller war von 1905–1907 Dekan der Bauingenieurschule und 1912/13 Rektor der TH in Wien. Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden durch zahlreiche Ehrungen anerkannt, u.a. durch die wirkliche Mitgliedschaft in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien (ab 1916) und in der Leopoldina in Halle (ab 1918). 1925 wurde ihm das Ehrendoktorat der TH Karlsruhe verliehen. Zu seinen Schülern gehörten bedeutende Mathematiker wie Richard von Mises, Karl Strubecker und Leopold Vietoris.
Emil Müller starb am 1.9.1927 in Wien.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 18 / April 2011
Vor 100 Jahren lud der damalige Rektor der Technischen Hochschule (TH) in Wien, Hans Jüptner von Jonstorff, zur ersten „Konferenz der Rektoren aller österreichischen Hochschulen“. Am 27. und 28. April
1911 traf man sich im Festsaal der TH. Nur der Rektor der Universität Wien ließ sich „krankheitshalber“ entschuldigen. Tatsächlich befürchteten er und der Akademische Senat, dass die Interessen der Universität Wien auf der Konferenz „majorisiert“ werden könnten: Hauptthema der Konferenz war nämlich die dienstrechtliche Stellung der Professoren.
Die Gastgeberrolle der Wiener Technik kam nicht von ungefähr: Seit den 1890er Jahren hatte sie wiederholt Tagungen, insbesondere der Technik-Rektoren, organisiert, um auf diese Weise hochschulpolitische Forderungen zu lancieren. Ab 1911 wurden nun jährlich „Allgemeine Rektorenkonferenzen“ veranstaltet, wobei die Universität Wien 1912 die Führungsrolle übernahm. Erst 1985 wurde mit Walter Kemmerling wieder ein Vertreter der TU Wien zum Vorsitzenden der Rektorenkonferenz gewählt. Bis 1917 arbeiteten die Rektoren deutsch-, tschechisch- und polnischsprachiger Hochschulen der österreichischen Reichshälfte gemeinsam an der Erreichung standes- und hochschulpolitischer Ziele. So wurde etwa schon 1912 über die Zulassung von Frauen zu technischen Studien diskutiert.
In der Ersten Republik fanden bis 1935 regelmäßige Treffen unter Federführung der Universität Wien statt. Nach 1945 bauten die Rektoren ihr Netzwerk wieder auf und suchten auch die informelle Zusammenarbeit mit dem Unterrichtsministerium. Mit dem Hochschulorganisationsgesetz 1955 wurde die Österreichische Rektorenkonferenz (ÖRK) als Beratungsorgan gesetzlich verankert.
Im UG 2002 ist die ÖRK nicht mehr vorgesehen. Deshalb wurde sie 2003 als gemeinnützige Organisation privaten Rechts neuerlich gegründet. Seit 2008 nennt sie sich „Österreichische Universitätenkonferenz“: Immerhin gibt es zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch Rektorinnen.
Paulus Ebner, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 17 / Jänner 2011
Rudolf Steiner ist bekannt als Begründer der Anthroposophie, als Schriftsteller und als Schöpfer der "Waldorf-Pädagogik". Weniger bekannt ist, dass er auch an der Wiener Technischen Hochschule (TH) studiert und hier für seine weitere Entwicklung entscheidende Kontakte geknüpft hat.
Vor 150 Jahren, am 27. Februar 1861, wurde Steiner als Sohn eines Südbahn-Beamten in Kraljevac (Kroatien) geboren. Der Vater bemühte sich um eine gehobene Schulbildung für seinen lernbegierigen Ältesten, und so konnte dieser nach Absolvierung der Realschule in Wiener Neustadt 1879 an der "Allgemeinen Abteilung" der TH in Wien inskribieren. Sein Berufsziel war zunächst das Lehramt an Realschulen. Da die Familie mittellos war, finanzierte er sein Studium durch Privatunterricht und, ab 1880, durch ein Ghega-Stipendium. An der "Technik" hörte Steiner Vorlesungen aus Physik, Chemie und Mathematik, wobei ihn die Vorträge des Physikers Edmund Reitlinger besonders beeindruckten. Daneben belegte er als a.o. Hörer an der Wiener Universität auch philosophische Fächer.
Für sein weiteres Leben entscheidend sollte jedoch die Begegnung mit Karl Julius Schröer (1825–1900) werden. Der Literaturhistoriker und Goetheforscher lehrte seit 1867 Deutsche Literaturgeschichte an der TH Wien. Steiner hörte bei ihm wiederholt Vorlesungen, insbesondere zu Goethes Dichtungen, Leben und Werk, und wurde bald auch in seinen privaten Bekanntenkreis aufgenommen. Schröer vermittelte ihm die Tätigkeit als Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes im Kürschner-Verlag. Damit ermöglichte er Steiner den Schritt in eine Existenz als freier Schriftsteller, und so verließ dieser 1883 die TH Wien ohne Abschluss.
Sein weiterer Lebensweg führte ihn 1897 nach Berlin und später nach Dornach (Schweiz). 1913 gründete er die „"Anthroposophische Gesellschaft" und begann mit dem Bau eines ersten "Goetheanums" in Dornach als zentrale Lehr- und Kultstätte seiner Bewegung. 1919 leitete er die erste Waldorf-Schule in Stuttgart. Daneben propagierte er unermüdlich in Büchern, Artikeln und Vorträgen die anthroposophische Weltanschauung. Einer seiner letzten Auftritte fand 1922 im Rahmen des "West-Ost-Kongresses" im Wiener Musikverein statt.
Rudolf Steiner starb am 30.3.1925 in Dornach.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 16 / Oktober 2010
Am 1. Oktober 1910, also vor 100 Jahren, wurde an der damaligen TH in Wien erstmals eine Lehrkanzel für Schiffsbau eingerichtet. Der unmittelbare Anstoß dazu ging vom k.k. Handelsministerium aus, das angesichts eines 1907 erlassenen Gesetzes zur Förderung der österreichischen Schifffahrt einen Mangel an inländischen Ausbildungsstätten für Schiffsingenieure feststellte. Das Professorenkollegium des Wiener Polytechnischen Instituts hatte zwar schon 1864 in einem Reorganisationsvorschlag die Einrichtung einer „Fachschule für Schiffsbau und Nautik“ gefordert, war damit aber nicht durchgedrungen. Um 1900 wurde jedoch sowohl der Ausbau der österreichisch-ungarischen Handelsmarine vorangetrieben als auch ein umfangreiches militärisches Flottenprogramm aufgelegt. Der gesteigerte Bedarf an entsprechend qualifizierten Ingenieuren konnte im Rahmen der seit 1906 an der TH Wien eingerichteten Honorardozenturen für Schiffsbau und Schiffstechnik nicht mehr gedeckt werden.
Als erster o. Prof. für „Schiffstheorie, Schiffskonstruktion, praktischen Schiffsbau und Werftwesen“ wurde der bisherige Honorardozent Heinrich Wagner (1863–1922) berufen. Er hatte, wie viele seiner Kollegen und Nachfolger, nach einem Maschinenbaustudium an der TH in Wien eine Karriere bei der k.u.k. Kriegsmarine eingeschlagen, bevor er an die Hochschule zurückkehrte. Wagner war maßgeblich an der Erstellung eines eigenen Curriculums beteiligt. Mit 17. September 1912 wurde eine eigene Unterabteilung für Schiffsbau und Schiffsmaschinenbau im Rahmen der Fakultät für Maschinenwesen errichtet. Die „Wiener Schule“ des Schiffsbaus erwarb sich unter Wagner und seinem Nachfolger Eckert-Labin, trotz ihrer stets sehr geringen Absolventenzahlen, bald einen guten Ruf.
Die Unterabteilung (ab 1940 Abteilung) für Schiffsbau blieb bis 1956 bestehen. Danach war die Studienrichtung „Schiffstechnik“ (ab 1975 „Wahlplan E“ des Maschinenbaustudiums) durch zwei Lehrkanzeln vertreten, die 1980 zu einem „Institut für Schiffbau“ zusammengefasst wurden. 1989 erfolgte dessen Zuordnung zum Institut für Leichtbau und Flugzeugbau. 1992 wurde die Studienrichtung „Schiffstechnik“ mangels Bedarf gänzlich aufgelassen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 15 / Juni 2010
Die Frage, warum die TU Wien nicht über ein dekoratives Siegel verfügt, wird dem Archiv öfters gestellt. Tatsächlich verwendete das k.k. polytechnische Institut, als kaiserliche „Staatsanstalt“ gegründet, ebenso wie die k.k. Technische Hochschule in Wien für hoheitliche Zwecke ein Siegel mit dem kaiserlichen Doppeladler (z.B. für Stempel auf Zeugnissen).
Im April 1919 beschloss jedoch das Professorenkollegium, einen Wettbewerb zur Schaffung eines Hochschulsiegels auszuschreiben. Gewinner war der Entwurf des akad. Bildhauers Oskar Thiede, der einen geflügelten Jüngling (zunächst als „der Flieger“, später meist als „Ikarus“ bezeichnet) mit der Umschrift „Technische Hochschule in Wien“ darstellte. Die Ausführung wurde dem Medailleur Heinrich Zita übertragen. Verwendet wurde das neue Siegel ab dem Studienjahr 1925/26 bis 1938. In der NS-Zeit trat an seine Stelle das sog. „kleine Reichssiegel“ (deutscher Reichsadler mit Hakenkreuz). Offiziell wurde die Benutzung des „Ikarus“-Siegels jedoch erst nach Kriegsende 1945 verboten und stattdessen ein Siegel mit dem Wappenadler der Zweiten Republik vorgeschrieben.
Dennoch blieb das Thema „Siegel“ virulent. Noch im Herbst 1944 veranstaltete der damalige Rektor der TH in Wien, Heinrich Sequenz, einen Wettbewerb zur Schaffung eines neuen Hochschulsiegels, der jedoch von den politischen Ereignissen überholt wurde.
1958 beauftragte das Professorenkollegium neuerlich die Künstler Rudolf Eisenmenger und Erich Pieler mit dem Entwurf eines „Wappens“ für die Hochschule. Die Entwürfe konnten bisher leider nicht aufgefunden werden, offenbar wurde das Thema auch nicht weiter verfolgt. 1962 veranstaltete die Hochschülerschaft der TH in Wien einen Wettbewerb für ein „Abzeichen“ der Hochschule, „da wir der Ansicht sind, dass es für eine so große und bekannte Hochschule unbedingt notwendig ist, ein Abzeichen zu haben“. Auch von diesem Wettbewerb ließen sich leider keine Ergebnisse auffinden.
Mit der Umbenennung in Technische Universität Wien aufgrund des UOG 1975 wurde damit begonnen, ein einheitliches Signet für den öffentlichen Auftritt der TU Wien zu realisieren. Ab November 1975 war erstmals ein „TU“-Logo für Drucksorten in Gebrauch.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 14 / April 2010
Der 100. Todestag Karl Luegers am 10. März 2010 hat ein überraschend breites Medienecho gefunden. Forderungen wie die nach der Umbenennung des Dr. Karl Lueger–Rings vor der Universität zeigen, wie sehr dessen Person bis heute polarisiert. Auch am Hauptgebäude der TU Wien am Karlsplatz befindet sich eine Lueger-Gedenktafel, und auch hier wurden schon Forderungen laut, sie zu entfernen, da sie von „den Nazis“ angebracht worden sei. Was hat es mit dieser Tafel auf sich?
Inhaltlich verweist sie darauf, dass Karl Lueger am 24. Oktober 1844 im Gebäude des damaligen Polytechnischen Instituts geboren wurde. Sein Vater, Leopold Lueger, war von 1839–1866 am Institut beschäftigt, wo er sich vom Hausknecht zum Aufseher im Technologischen Kabinett emporarbeitete. 1839–1849 hatte er eine Dienstwohnung im Institutsgebäude, wo sein Sohn Karl zur Welt kam. Soweit die Fakten.
Am 18. März 1910, kurz nach Luegers Ableben, beschloss die Bezirksvertretung Wieden, am Gebäude der Technischen Hochschule eine Gedenktafel anbringen zu lassen. Das um Stellungnahme ersuchte Rektorat befand, dass dagegen „kein Anstand“ bestehe. Allerdings wurde dieses Vorhaben, aus Gründen, die nicht zu eruieren waren, nicht durchgeführt.
Im Jahr 1943 griff der emeritierte Professor für Geodäsie Eduard Dolezal die Idee wieder auf, im Hinblick auf Luegers nahenden 100. Geburtstag. Eine Rückfrage bei der Gemeinde Wien wurde offenbar positiv beschieden. Daher beauftragte man den Schrift-Graphiker Otto Hurm mit der Gestaltung, und am 24. Oktober 1944 wurde die Gedenktafel feierlich enthüllt.
Leider sind im Archiv der TU Wien die Motive für ihre Anbringung nicht mehr nachvollziehbar. 1943/44 wird der von Lueger vor allem während seines politischen Aufstiegs virtuos als Strategie eingesetzte Antisemitismus ins Gewicht gefallen sein, zumal Hitler ihn als eines seiner großen Vorbilder apostrophiert hatte (obwohl sich Lueger stets von Schönerer und dessen „Rassen“-Antisemitismus distanziert hatte). Dennoch war Lueger auch ein bedeutender Bürgermeister, der für Wien die Epoche der Kommunalisierung eingeleitet und u.a. große Teile der bis dahin privat geführten öffentlichen Infrastruktur, wie Gas- und Elektrizitätsversorgung und öffentlichen Verkehr in städtische Regie übernommen hat. Die Tafel sollte uns heute an beides erinnern.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 13 / Jänner 2010
Überfüllungszustände sind an der TU Wien keine neue Erscheinung. Die vorgeschlagenen Methoden zu ihrer Beseitigung auch nicht.
An der TH Wien wurden erstmals ab 1902/03 Maßnahmen zur Beschränkung der Hörerzahl eingeführt. Hauptprobleme waren, bei insgesamt 2525 ordentlichen Hörern, der Mangel an Zeichensälen für die konstruktiven Fächer sowie an Laborkapazitäten. Die Mobilisierung interner Raumreserven brachte keine dauerhafte Lösung, und sowohl Appelle des Professorenkollegiums als auch des ÖIAV (Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein) an das zuständige Ministerium, mehr Ressourcen für eine räumliche Erweiterung und die Verbesserung der Ausstattung mit Labors und Lehrpersonal bereitzustellen, erwiesen sich als fruchtlos. Daher beantragte die Hochschule im Juli 1902 beim Ministerium für das kommende Studienjahr eine Aufnahmebeschränkung für Erstinskribierende.
Sie wurde in der Form genehmigt, dass künftig vorrangig Hörer aus Niederösterreich und den Kronländern ohne TH aufgenommen werden sollten, alle übrigen Bewerber und Ausländer nur nach Maßgabe der vorhandenen Plätze. Diese Regelung blieb bis 1914/15 aufrecht, trotz wiederholter Proteste der Studierenden, die eher für eine bessere Ressourcenausstattung plädierten. Auch ein Vorstoß der Professorenschaft 1913, statt der geographischen qualitative Auswahlkriterien, wie eine Aufnahmeprüfung, anzuwenden (wegen der hohen Drop-out-Raten von ca. 25%), wurde abgelehnt.
Viel genutzt hat der Numerus clausus nicht, da die Hörerzahlen weiter stiegen. Erst der I. Weltkrieg führte zu einer drastischen Reduktion. Als nach Kriegsende die Studierendenzahlen erneut sehr rasch anstiegen (bis auf 5070 HörerInnen 1921/22), griff man erneut auf das probate Mittel zurück: Vorrangig durften ab 1920 „Deutsch-Österreicher“ (ausgenommen Studierende aus der Steiermark, weil es dort eigene technische Hochschulen gab) inskribieren, dann HörerInnen aus der Steiermark, und dann ggf. AusländerInnen. Frauen rangierten hinter Männern. 1923 wurde dieses System auf Druck der „Deutschen Studentenschaft“ ergänzt durch eine generelle Beschränkung des Anteils ausländischer jüdischer HörerInnen auf 10% der Gesamtzahl der Studierenden – Vorbote einer weitaus drastischeren Eliminierungspolitik ab 1938. Nach 1945 wurden, trotz zeitweise dramatischer Überfüllung, keine formellen Zugangsbeschränkungen mehr erlassen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 12 / Oktober 2009
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 an der Technischen Hochschule in Wien
Der Kriegsausbruch im Herbst 1939 kam nicht ganz überraschend. In den Monaten zuvor hatte es verdeckte Vorbereitungen gegeben, z.B. die Registrierung von Vermessungsgeräten an den Hochschulen. Im August war eine größere Anzahl von Hochschulangehörigen zu „militärischen Übungen“ einberufen worden. Der Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September veränderte jedoch die Situation grundlegend.
Ab 2. September wurde für das Personal der TH in Wien eine Urlaubssperre verhängt. Alle nicht eingerückten Angehörigen der Hochschule waren an „geeigneter“ anderer Stelle einzusetzen, falls sie nicht den Nachweis einer „kriegswichtigen“ Beschäftigung beibringen konnten. Am 14. September erging der erste von zahllosen weiteren Sparerlässen, verbunden mit einer strikten Rohstoff- und Materialbewirtschaftung, die „kriegswichtigen“ Belangen Priorität einräumte. Damit begannen die für die Personalwirtschaft während des Krieges so typischen „uk-(unabkömmlich) -Stellungen“. Viele Wissenschafter versuchten, ihre Forschungsvorhaben so anzulegen, dass sie als kriegswichtig anerkannt wurden, und Mitarbeiter durch Einbindung in entsprechende Projekte „uk“ stellen zu lassen und so vor einer Einrückung zu bewahren.
Kurzzeitig drohte der TH in Wien sogar die existenzielle Gefährdung: Am 11. September wurde „bis auf weiteres“ ihre völlige Schließung verordnet. Studierende, soweit sie nicht einrücken mussten, wurden zur Fortsetzung ihres Studiums an die THs in München und Berlin verwiesen. Begonnene Arbeiten und Prüfungen durften noch abgeschlossen werden. Nach Bekanntwerden dieser Verfügung hagelte es Anfragen von verunsicherten HörerInnen. Die deutschen THs waren auf einen Zustrom österreichischer Studierender nicht vorbereitet, viele von diesen konnten sich auch ein Studium im „Reich“ nicht leisten. Nach massiven Protesten insbesondere der Studentenführung durfte die Wiener Technik ab 1.10.1939 den Studienbetrieb doch wieder aufnehmen: Ingenieure wurden für den Krieg gebraucht. Zur Erhöhung des Outputs führte man kurzzeitig Trimester ein (die sich aber nicht bewährten), zur Effizienzsteigerung wurden neue „Leistungsnachweise“ vorgeschrieben. Tatsächlich ging die Anzahl der Studierenden 1939/40 nur leicht zurück.
Durch all diese Maßnahmen wurden die Hochschulen, auch die TH in Wien, von Beginn an in den Dienst des Krieges gestellt.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 12 / Juli 2009
Schon 1828 gab es Überlegungen, eine von Kaiser Franz I. gewünschte nationale Ausstellung der neuesten Gewerbsprodukte im Gebäude des Instituts unterzubringen. Dies erwies sich jedoch aus Raummangel als nicht realisierbar. Daher stellte der Kaiser für die erste derartige „Industrieausstellung“ 1835 noch knapp vor seinem Tod die kaiserliche Winterreitschule und die Wagenremisen des Hofes zur Verfügung. Zugleich wurde Prechtl aufgefordert, Vorschläge zu erarbeiten, wie in Zukunft eine solche Ausstellung alle drei Jahre im Gebäude des Wiener polytechnischen Instituts veranstaltet werden könnte.
Er schlug (wie schon 1828) eine Erweiterung des bestehenden Hauptgebäudes vor. Dazu legte er Pläne sowie eine Vorkalkulation vor, die von dem Professor für Land und Wasserbau, Josef Stummer, angefertigt worden waren. Vorgesehen war der Ersatz des parallel zum Institutsgebäude bestehenden einstöckigen Bautraktes sowie der Seitentrakte und des an die Paniglgasse angrenzenden Quertraktes. Sie stammten noch aus dem 18. Jh., wurden provisorisch für den Unterricht genutzt und befanden sich in schlechtem Zustand. Prechtl und Stummer hatten sich dabei nicht nur Gedanken über die Gestaltung der Ausstellung gemacht, sondern schlugen auch Nachnutzungen vor: So sollte der 1. Stock des neuen Mitteltraktes später zur Unterbringung des k.k. FabriksProduktenKabinetts dienen, der 2. Stock war für die Bibliothek samt Lesesaal vorgesehen. Als Gesamtkosten waren 336.000 Gulden kalkuliert (am Ende wurden es dann rd. 380.000 fl).
Der Plan erhielt am 2.4.1836 die kaiserliche Genehmigung, die Bauleitung wurde an Stummer übertragen. Zugleich wurde er ermahnt, beim Bau „strengste Sparsamkeit, unbeschadet der Solidität“ walten zu lassen, unter „Weglassung alles dessen, was ein entbehrlicher Luxus wäre“. Dennoch sollte darauf geachtet werden, „nur vollkommen gutes Baumaterial“, insbesondere mindestens 3 Jahre abgelagertes Holz zu verwenden.
Die Bauarbeiten begannen im August 1836 – zuvor mussten Unterrichtsräume, Labors und auch 14 Dienerwohnungen umgesiedelt werden. 1838 wurde zusätzlich der Bau eines Pavillons im 2. Hof begonnen, „zur Unterbringung von Wägen“. Die Fertigstellung der Gebäude erfolgte, später als geplant, im April 1839, so dass die Gewerbeausstellung erst im Mai 1839 stattfinden konnte. Sie war mit 597 Ausstellern ein großer Erfolg – auch für das polytechnische Institut, das ihr die größte bauliche Erweiterung des 19. Jahrhunderts zu verdanken hatte.
Auch die nächste und letzte derartige Gewerbeausstellung 1845 fand übrigens im Institut statt. Diesmal wurden jedoch, unter der Leitung von Paul Sprenger, nur umfangreiche hölzerne Zubauten errichtet und danach wieder abgebrochen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 10 / April 2009
Der Zugang zum Technikstudium für Frauen erfolgte in Österreich mit deutlicher Verzögerung. Die Öffnung der Universitäten 1897 galt zunächst nur für die philosophischen Fakultäten, seit 1900 auch für Medizin und Pharmazie. Die technischen Studien blieben Frauen weiterhin verschlossen.
Dennoch suchten bereits ab 1899 Frauen um Zulassung als sog. „Hospitantinnen“ (Gasthörerinnen) an technischen Hochschulen an. An der TH in Wien ist die erste Hospitantin im Jahr 1908 registriert.
Nachdem ab 1907 für Lehrkräfte an höheren Handelsschulen und Mädchenlyzeen ein universitäres Fachstudium vorgeschrieben wurde, konnte 1913 immerhin erreicht werden, dass Lehramtskandidatinnen als a.o. Hörerinnen an technischen Hochschulen jene Fächer inskribieren durften, die ausschließlich dort gelehrt wurden (Darstellende Geometrie und Freihandzeichnen). Ihre Zahl war jedoch sehr gering.
Ansuchen, auch andere Fächer als a.o. Hörerinnen inskribieren zu dürfen, wurden von der Unterrichtsverwaltung stets „aus prinzipiellen Erwägungen“ abgelehnt. Die Einstellung der Hochschulen zum Frauenstudium war zunächst gespalten. Die erste Diskussion zu diesem Thema im Professorenkollegium der TH in Wien fand im Jahre 1910 statt. Die dabei vorgenommene Abstimmung ob Frauen prinzipiell zum Technikstudium zugelassen werden sollten, ergab damals eine hauchdünne Mehrheit von 19:18 für die „Befürworter“. Spätere Abstimmungen kamen zu einem ähnlichen Ergebnis.
Unter dem Eindruck der Erfahrungen des I. Weltkriegs sprachen sich die Hochschulen ab 1916 mehrheitlich für eine Zulassung von Frauen aus. Insbesondere die nicht-deutschsprachigen THs plädierten dafür, sowohl aus Gleichheitsgründen als auch, weil ihnen eine Tätigkeit von Frauen in technischen Berufen gut vorstellbar erschien. Die deutschsprachigen THs zeigten sich dagegen deutlich konservativer.
Nach dem Zerfall der Donaumonarchie wurden in den Nachfolgestaaten noch 1918 die THs für Frauen geöffnet. In „Deutsch-Österreich“ erfolgte dies erst unter dem sozialistischen Staatssekretär für Unterricht Otto Glöckel. Seine Verordnung vom 21. April 1919 erlaubte Frauen die ordentliche Inskription an technischen Hochschulen – freilich nur soweit, als sie den männlichen Hörern keine Studienplätze wegnähmen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 9 / Jänner 2009
Als 2001 mit dem Abriss des sog. Lehártraktes am Getreidemarkt begonnen wurde, endete damit ein 90 Jahre währendes Provisorium.
Das Gebäude der ehemaligen k.u.k. Kriegsschule, 1862 – 1864 auf den Gründen des früheren Jesuitenhofs an der Dreihufeisengasse (heute Lehárgasse) errichtet, wurde der Wiener Technischen Hochschule vom deutsch-österreichischen Staatsamt für Heerwesen im Dezember 1918 zur Nutzung zugesprochen.
Nach Ausrufung der Republik (Deutsch-)Österreich Ende Oktober 1918 war die Demobilisierung des k.u.k. Heeres und die Auflösung der Kaiserlichen Militärverwaltung sofort in Angriff genommen worden. Noch im November dürfte der damalige Dekan der Chemisch-Technischen Fachschule, Max Bamberger, beim Staatsamt für Heerwesen vorgesprochen und sich um Überlassung des Kriegsschulgebäudes bemüht haben.
Gerade die chemischen Lehrkanzeln hatten schon seit Jahrzehnten unter fehlenden Laborkapazitäten gelitten. Mehrere Ausbauprojekte hatten sich noch vor dem ersten Weltkrieg zerschlagen. Als ab 1918 jedoch so viele Studierende wie nie zuvor an die Hochschule zurückströmten, war dringender Handlungsbedarf gegeben. Da kam die Aussicht auf eine Nutzung des Gebäudes der aufgelösten Kriegsschule, das sich damals offenbar noch in recht gutem Zustand befand, für „Notlabors“ gerade recht. Bamberger erreichte nicht nur die Widmung der ehemaligen Kriegsschule für die TH in Wien, sondern im Frühjahr 1919 auch noch die Bereitstellung „eines sehr namhaften Betrages“ für die Errichtung von Labors. Au§erdem wurden aus der Sachdemobilisierung über 300 Zeichentische mit zugehörigen Sesseln, sowie weitere Möbel der Kriegsschule für die Ausstattung erworben.
Am 14. Mai 1919 beschloss das Professorenkollegium, dass an der Dreihufeisengasse physikalische Hörerlabors, die Lehrkanzeln für Chemische Technologie organischer Stoffe, für Technische Elektrochemie, für Physikalische Chemie, für Gärungsphysiologie und Bakteriologie sowie Räume für Lötrohrübungen der Lehrkanzel für Mineralogie untergebracht werden sollten.
Die Umbauarbeiten begannen im September 1919 – obwohl die im Gebäude ansässigen militärischen Dienststellen erst Ende 1919 tatsächlich alle ausgezogen waren – und bereits am 27. 10. 1919 konnten die ersten Labors im II. Stock, bald darauf auch jene im III. Stock bezogen werden. Weitere Lehrkanzeln folgten im Laufe des Studienjahres. Auch die „mensa technica“ war zeitweise dort untergebracht.
Das Gebäude der Geniedirektion und des k.u. k. Technischen Militärkomitees, auf dem gleichen Areal zum Getreidemarkt hin gelegen und von Bamberger ebenfalls für die TH Wien ins Auge gefasst, sollte allerdings von der Militärverwaltung vorerst für eigene Zwecke genutzt werden. Erst ab Mitte der 1920er Jahre konnte auch dieser Komplex für die Hochschule, insbesondere für Institute des Maschinenbaus, gewonnen und adaptiert werden.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 8 / Oktober 2008
Als die provisorische Nationalversammlung in Wien am 12. 11. 1918 die „Republik Deutsch-Österreich“ proklamierte, folgte sie damit dem Beispiel der übrigen Nationalitäten der ehemaligen Donaumonarchie, die schon in den letzten Oktobertagen eigene Nationalstaaten begründet hatten. Dieser Akt hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Wiener Technische Hochschule, obwohl die Folgen erst allmählich in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar wurden.
Das Professorenkollegium der bisherigen k.k. TH in Wien richtete Anfang November eine Loyalitätserklärung an den deutsch-österreichischen Staatsrat und versicherte: „Die Wiener Technische Hochschule stellt sich freudig in den Dienst des neubegründeten Vaterlandes, um in ihrem Schaffensbereiche an der Wiedergeburt des deutschen Volkes aus schwerer Prüfung mitzuwirken, von dem sie die Mittel zur Lösung ihrer großen Aufgaben mit Zuversicht erhofft.“ Die anstehenden Aufgaben waren in der Tat beachtlich: Die Studierenden strömten an die Hochschule zurück: Binnen eines Jahres erhöhte sich die Zahl der Inskribierten von 625 im Sommer 1917 auf über 4.000 im Herbst 1918. Die Hochschuleinrichtungen selbst waren nach vier Jahren ohne Ersatzinvestitionen heruntergekommen, es fehlte an Heizmaterial, Lebensmitteln und sonstigen Bedarfsgütern.
Strukturell blieb vorerst alles beim Alten – es wurden sogar die alten Zeugnisformulare mit dem kaiserlichen Doppeladler weiter verwendet, nur das „k.k.“ wurde ausgestrichen –, doch die neuen demokratischen Impulse machten sich auch an der Hochschule bemerkbar.
Die Gruppen der akademischen Community begannen sich gemäß ihren Interessen zu organisieren. So veröffentlichten die „Wissenschaftlichen Hilfskräfte“ der TH in Wien (d.h. die Assistenten) eine Denkschrift, in der sie eine klarere Definition ihrer Stellung, bessere Besoldung und eine Art Karrieremodell forderten (übrigens mit Erfolg, wie das Assistentengesetz von 1919 zeigt); die Privatdozenten folgen Anfang 1919 mit ähnlichen Forderungen. Von Seiten der Studierenden bildeten sich auch neue politisch ausgerichtete Gruppierungen. So konstituierte sich am 21. 11. 1918 an der Wiener Hochschule eine „allgemeine Technikerversammlung“ als „allgemeiner Studentenausschuss“. Er wurde jedoch schon im Dezember von Angehörigen der „Deutschen Lesehalle“ und anderer Korporationen gesprengt und durch einen „deutsch-nationalen“ Hochschulausschuss ersetzt.
Die neue Staatsform machte für die öffentlich Bediensteten auch einen neuerlichen Diensteid auf die Republik erforderlich. Zur Vereidigung, die im Dezember 1918 stattfanden, waren nur Personen zugelassen, die der „deutschen Nation“ angehörten. In diesem Zusammenhang fasste das Professorenkollegium der TH in Wien am 6. 12. 1918 einen Beschluss, worin der „in der Vergangenheit klar begründete(.) deutsche(.) Charakter der Hochschule ausdrücklich betont“ und erklärt wurde, dass man „bestrebt sein werde, nicht nur die deutsche Sprache als Unterrichts- und Amtssprache unzweifelhaft festzulegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass den im Lehrkörper befindlichen, zur deutsch-österreichischen Nation sich nicht bekennenden Angehörigen fremder Nationalität, insoweit diese nicht als Lektoren an der Hochschule fremde Sprachen dozieren, die Lehrausübung entzogen werde.“ Tatsächlich wurden einige Lehrpersonen aufgrund ihrer „nichtdeutschen Nationalität“ nicht vereidigt und mussten aus dem Personalstand der Hochschule ausscheiden. Hier zeichnen sich bereits die politischen Bruchlinien ab, die das Klima an der TH in Wien in den nächsten Jahrzehnten prägen sollten.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 6 / April 2008
Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland heuer vor 70 Jahren hatte auch auf die Wiener Technische Hochschule sofortige und tief greifende Auswirkungen. Schon seit dem „Berchtesgadener Abkommen“ vom 12. Februar 1938, bei dem Hitler unter Einsatz schwerer psychischer Gewalt dem österreichischen Bundeskanzler Schuschnigg u.a. das Zugeständnis abrang, österreichische Nationalsozialisten in seine Regierung aufzunehmen und eine Generalamnestie für illegale NSDAP-Anhänger zu erlassen, wuchs die Unruhe an der Hochschule. Im März überstürzten sich dann die Ereignisse.
Für den 11. März 1938 war der Unterrichtsbetrieb an der TH in Wien wegen der herrschenden „politischen Hochspannung“ vorübergehend ausgesetzt worden. Am 12. März hätten sich die Bediensteten der Hochschule im Festsaal des Hauptgebäudes am Karlsplatz zur von Schuschnigg angeordneten Volksabstimmung einfinden sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Stattdessen versammelte sich am 13. März, einem Sonntag, das Professorenkollegium unter dem Vorsitz des Rektors und gab seiner „freudigen Genugtuung“ darüber Ausdruck, dass „in Österreich der deutsche Volksgedanke zum vollen Durchbruch gelangt“ sei. Nur wenige Stunden später erklärte Holey (der als Anhänger des Ständestaats galt) schriftlich seinen Verzicht auf das Rektorsamt. Der Prorektor, Prof. Friedrich Böck, schloss sich an. In der für Montag, den 14. März kurzfristig angesetzten außerordentlichen Kollegiumssitzung wurden beide Rücktritte angenommen und die vorläufige Geschäftsführung des Rektorats „einstimmig per acclamationem“ Prof. Saliger als dienstältestem Mitglied des Professorenkollegiums übertragen. Ferner wurden weitere, bereits getroffene Personalmaßnahmen verkündet: Das Gesuch des jüdischen Professors für Physikalische Chemie Emil Abel um vorläufige Enthebung sowie der Rücktritt des Dekans der Fakultät für Bauingenieurwesen, Prof. Karl Wolf, wurden „angenommen“ und der ebenfalls jüdische Leiter der Rektoratskanzlei Dr. Josef Goldberg beurlaubt – dies alles noch ohne jede Rechtsgrundlage, die erst am 31. Mai 1938 nachgereicht wurde.
Am 17. März wurden in einer neuerlichen außerordentlichen Sitzung des Professorenkollegiums die Rücktritte von Rektor und Prorektor sowie die übrigen bisher erfolgten Enthebungen mitgeteilt und als politisch notwendige Maßnahmen gerechtfertigt. Es folgte eine Kundgebung des gesamten Personals der Hochschule, die, ganz im Stil der neuen Zeit, mit Absingung des Deutschland- und des Horst-Wessel-Liedes schloss.
Für den 22. März war im Festsaal die feierliche Vereidigung der Beschäftigten auf den „Führer“ angeordnet worden. Die Teilnahme war verpflichtend und musste mit Unterschrift bestätigt werden. Jüdischen Angehörigen der Hochschule war dagegen die Eidesleistung verboten, was eine entsprechende Überprüfung der knapp über 500 MitarbeiterInnen der Hochschule voraussetzte. Dass für die meisten von ihnen politische Zuverlässigkeit und/oder „rassische Würdigkeit“ innerhalb von knapp zehn Tagen hatte festgestellt werden können, lässt auf eine außerordentlich gute Vorbereitung schließen.
Insgesamt wurden als Ergebnis dieser Erhebungen 40 Angehörige des wissenschaftlichen Personals (13,2%), überwiegend Privatdozenten und Assistenten, und acht Angehörige des nicht-wissenschaftlichen Personals (4,1%) vorerst enthoben, davon etwa zwei Drittel aus „rassischen“ Gründen. Die meisten wurden später auch tatsächlich entlassen.
Ursprünglich sollte der Unterrichtsbetrieb am 21. März wieder aufgenommen werden, was allerdings durch die weitere politische Entwicklung, insbesondere durch die Veranstaltung der Volksbefragung am 10. April, nicht realisiert werden konnte. Tatsächlich wurde die TH in Wien, wie alle anderen wissenschaftlichen Hochschulen in Österreich, erst am 25. April 1938 feierlich wieder eröffnet.
Nicht wieder zum Unterricht antreten durften die jüdischen Hörerinnen und Hörer. Ihr Anteil an den Studierenden sank im Sommersemester 1938 auf 1,3% und damit noch unter den mit Erlass vom 23.4.1938 festgesetzten Numerus Clausus von 2%. Die Anzahl der Studierenden jüdischer Konfession allein ging von 216 auf 16 zurück. Der Gesamtverlust an Hörerinnen und Hörern muss aber weit höher gewesen sein, da die NS-Definition der „Nicht-Arier“ über die Konfessionszugehörigkeit hinaus griff und auch „arische“ Studierende die Hochschule aus politischen Gründen verließen.
Die wenigen Wochen des „Umbruchs“ (wie man damals gerne sagte) haben die Wiener Technische Hochschule also tatsächlich grundlegend verändert. Den erhofften Aufschwung haben sie allerdings nicht gebracht, wohl aber einen Verlust an intellektueller und menschlicher Kapazität, der lange nachgewirkt hat.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 5 / Jänner 2008
Nein, hier geht es nicht um die aktuellen Um- und Neubauprojekte der TU Wien. Vielmehr soll daran erinnert werden, dass heuer vor 190 Jahren das heutige Hauptgebäude am Karlsplatz als neues Institutsgebäude des k. k. polytechnischen Instituts in Wien besiedelt wurde.
Zwar hatte das Institut bereits am 6. 11. 1815 erstmals den Lehrbetrieb aufgenommen, allerdings vorerst nur in eingeschränktem Umfang. Als provisorische Unterkunft diente das ehemalige Herrenhaus samt Nebengebäuden, die sich auf dem 1814 für die Anstalt angekauften Gelände befanden (etwa zwischen dem heutigen Mitteltrakt und der Paniglgasse). Auf dem Platz davor war 1816 mit dem Neubau eines Institutsgebäudes begonnen worden. Nach der feierlichen Grundsteinlegung am 14. 10. 1816 sollte es kaum zwei Jahre dauern, bis der Bau im Frühsommer 1818 zumindest äußerlich fertiggestellt war. Mit a.h. Entschließung vom 15. 6. 1818 erfolgte die Festlegung der an der Hauptfassade anzubringenden Inschrift: „Der Pflege, Erweiterung, Veredelung des Gewerbsfleißes, der Bürgerkünste, des Handels. Franz der Erste 1815“ sollte sie lauten, auszuführen „in altrömischen Lapidar-Lettern nach Mustern des Antiken-Kabinettes“. Im September wurde eine kleine Änderung verfügt: Die Jahreszahl sollte entfallen, dafür sei „die Jahreszahl auf der Tafel der Muse der Geschichte in dem Figurenaufsatze durch Vergoldung nach Thunlichkeit sichtbar zu machen“.
Die Besiedelung des Hauses nahm einige Monate in Anspruch: Labors mussten eingerichtet werden, die Realschule sollte von ihrem Standort in der heutigen Annagasse in das Institutsgebäude umziehen, die Sammlungen, insbesondere das k. k. National-Fabriksproduktenkabinett, mussten in geeigneter Form aufgestellt und die übrigen Lehrkanzeln untergebracht werden. Noch 1818 wurde die Modellensammlung für die Mechanik und Maschinenlehre durch den Ankauf der berühmten Münchner Sammlung des Bauingenieurs Carl Friedrich v. Wiebeking erheblich erweitert, und auch die Lehrkanzel für Land- und Wasserbaukunst wurde, als letzte der vorgesehenen acht Professuren, mit Johann von Kudriaffsky besetzt. Ende September drängte die Direktion, man möge nun endlich mit dem Ausmalen
der Zimmer beginnen, damit diese Arbeit vor dem eigentlichen Einräumen vollendet sei.
Gleichzeitig bereitete Direktor Prechtl eine umfangreiche PR-Aktion vor: Mit Erlaubnis der Regierung ließ er im März 1818 bei Carl Gerold in Wien einen Auszug aus dem Organisationsplan, die „Verfassung“ des Instituts, in 6.000 Exemplaren drucken, zur Verteilung an Behörden, Ämter und sonstige Interessenten.
Der Beginn des Studienjahrs 1818/19 erfolgte ohne besondere Zeremonien. Wie auch später üblich, wurden Professoren und Assistenten des Instituts „eingeladen, am 3. November 1818 das Hl. Geistamt in der Karlskirche zu besuchen“ und sich dazu „um 1/2 9 Uhr im Commissionszimmer im neuen Institutsgebäude“ zu versammeln. Am 5. 11. 1818 wurde dann der Unterricht im neuen Gebäude erstmals in vollem Umfang aufgenommen.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 4 / Oktober 2007
Vielleicht haben Sie sich ja auch im Vorbeigehen schon gefragt, was es mit den acht würdigen Herren auf sich hat, die jeweils zu viert den Haupteingang des TU-Gebäudes am Karlsplatz flankieren? Oder sind sie Ihnen in ihrer noblen Zurückhaltung noch gar nicht aufgefallen?
Auf Abbildungen des Gebäudes aus dem 19. Jh. fehlen sie noch, da es sich um eine spätere bauliche Ergänzung des Hauptgebäudes handelt, die nicht auf die Initiative der Hochschule selbst zurückgeht, sondern auf die des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins (ÖIAV). Dieser trat Ende 1898 mit dem Vorschlag an das Professorenkollegium heran, „Statuen hervorragender Techniker im Gebäude der Technischen Hochschule“ aufzustellen. Nachdem die Professoren ihr grundsätzliches Einverständnis erklärt hatten, richtete der Verein am 27. Jänner 1900 einen Spendenaufruf an die Öffentlichkeit: Man wolle, so hieß es, den „geistigen Führern“ auf dem Gebiet der Technik eine „würdige“ und vor allem öffentlich sichtbare „Gedenkstätte“ errichten und so dazu beitragen, „auch den Technikern im Staate und in der Gesellschaft die ihnen gebührende Stellung und Anerkennung zu erringen“. Vorbild war der Arkadenhof der Wiener Universität. Eine standespolitische PR-Aktion also. Als Enthüllungsdatum war der 1. Oktober 1900 vorgesehen.
Ganz so rasch ging es dann doch nicht: Die Spendensammlung war offenbar weniger ergiebig als gehofft, sodass der ÖIAV beim Ministerium für Kultus und Unterricht um Subvention ansuchte. Das Professorenkollegium der TH in Wien teilte in einer Stellungnahme vom Juni 1900 mit, man sei für eine Aufstellung vor dem Hause und schlug als Standort „zunächst“ die Streifen „rechts und links des Hauptzugangs“ vor. Für die endgültige Gestaltung solle ein Wettbewerb erfolgen, der auch „die Gartenanlagen vor dem Hause zur Denkmal-Aufstellung“ einbeziehen solle. Offenkundig ist es aber doch bei der „provisorischen“ Aufstellung geblieben. Erst am 4. November 1903 wurde die Anlage feierlich enthüllt. Seitdem stehen dort die Hermen von acht ehemaligen Professoren der Hochschule, jede Büste von einem anderen Bildhauer gestaltet.
Die Anlage muss wahrhaft glanzvoll gewirkt haben, waren die Büsten doch ursprünglich vergoldet. Allerdings hatte man dabei wohl gespart und den Goldeffekt durch Lackierung erzielt. Bereits 1911 klagte der Rektor Wilhelm Suida, er werde wiederholt, sogar in Form anonymer Briefe, auf den schlechten Zustand der Büsten angesprochen, denn der Lack sei „teilweise durch Einfluss der Witterung abgewaschen..., was ein blatternarbiges Aussehen der Büsten bewirkt.“ Nach Beratungen mit Experten entschied der Rektor jedoch, nichts zu unternehmen und zu warten, bis der Lack von selbst völlig abblättere und sich eine Patina herausbilde, „die jedenfalls besser aussehen wird, als jemals die Vergoldung.“
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
Dieser Artikel erschien erstmals im TU|frei.haus Nr. 3 / Juni 2007
Am 27. 11. 1814 erfolgte die Genehmigung zum Ankauf der „Loséschen Gründe“ auf der Wieden aus dem Besitz des Großhändlers Georg von Sina durch die öffentliche Hand für die Errichtung des zukünftigen „k. k. polytechnischen Instituts in Wien“. Damit war eine Standortentscheidung getroffen worden, die die Geschichte der TU Wien bis heute prägt.
Ursprünglich hätte das Institut im ehemaligen Palais Kaunitz (heute Wien I., Johannesgasse 5) untergebracht und die Labors und Lehrsammlungen der Universität Wien mitbenutzt werden sollen. Johann Joseph Prechtls anspruchsvoller und auf Expansion ausgerichteter Organisationsplan (endgültig genehmigt 1818) hätte dort allerdings nicht realisiert werden können. Der damals außerhalb der Stadt gelegene Grund bot dagegen nicht nur Platz für ein großzügiges Institutsgebäude, sondern auch Raum für zukünftige Erweiterungen. Tatsächlich sollte es fast ein Jahrhundert dauern, bis die spätere TU Wien sich über diesen Standort hinaus ausdehnte. Das Institutsgebäude wurde vergleichsweise in Rekordzeit errichtet: Die Grundsteinlegung erfolgte am 14. 10. 1816, und bereits im Herbst 1818 konnte der Unterricht im neuen Domizil aufgenommen werden. Nur die Ausgestaltung des Festsaales nach Entwürfen von Peter Nobile und Joseph von Klieber zog sich noch bis 1842 hin.
Inzwischen war das Institutsgebäude erheblich erweitert worden: Bereits 1821 wurde der östliche Seitenflügel zur Unterbringung der mathematisch-astronomischen Werkstätte errichtet, 1836–1839 folgte der Anbau des Westflügels, des Mitteltraktes, des Panigltraktes, des Lammtraktes sowie eines Pavillons im 2. Hof (heute u.a. Lise-Meitner-Hörsaal). Anlass für diese Erweiterung war die Abhaltung der 2. österreichischen Gewerbsproduktenausstellung 1839, die Entwürfe stammten von Joseph Stummer, Professor für Land- und Wasserbaukunst.
Der Raumbedarf des Instituts (seit 1872 Technische Hochschule) war damit allerdings nicht lange gedeckt. Bereits ab 1867 wurde das Gebäude nach und nach um ein 3., später ein 4. und im 20. Jahrhundert auch noch um ein 5. Geschoss aufgestockt. 1907–1909 wurde nach Plänen von Professor Karl König der sogenannte Karlstrakt angebaut, 1910–1912 entstand im 2. Hof das Aeromechanische Laboratorium mit einem der weltweit ersten Windkanäle (heute Lokal „Nelson’s“). Dennoch blieb das „Raumproblem“ ein ständiges Thema für die Hochschule. 1902–1904 wurde auf einem Teil des Areals der Kunsterzgießerei in der Gußhausstraße, und damit erstmals außerhalb des Standorts „Karlsplatz“, das Elektrotechnische Institut nach Plänen von Christian Ulrich und Karl Hochenegg errichtet. Es wurde 1928 um das Schwachstrominstitut und 1967–1973 um das „Neue“ Elektrotechnische Institut (Entwurf: Erich Boltenstern) erweitert.
Gegen Ende des I. Weltkrieges gelang es, die Widmung der sogenannten Aspanggründe (1917) sowie von Gebäuden des ehemaligen k.u.k. Technischen Militärkomitees am Getreidemarkt (1919) für Zwecke der Hochschule zu erreichen. Der Getreidemarkt-Komplex konnte trotz wirtschaftlicher Probleme in der Zwischenkriegszeit adaptiert und um Gebäude für den Maschinenbau und die Chemisch-technische Fakultät erweitert werden, nach dem II. Weltkrieg von 1958 bis 1995 nochmals um das „Chemie-Hochhaus“. Dagegen kam die Nutzung der Aspanggründe, trotz zaghafter Anfänge 1921, kaum wirklich über das Planungsstadium hinaus.
Dafür wurde 1975–1987 auf dem Grund des ehemaligen „Freihauses“ für die nunmehrige (seit 1975) TU Wien ein neues Institutsgebäude errichtet, in das ab 1984 zahlreiche, v.a. mathematisch-naturwissenschaftliche Institute und Serviceeinrichtungen einzogen. 1984–1987 erhielt angrenzend die Universitätsbibliothek einen Neubau mit markanter Eckgestaltung.
Darüber hinaus wurden im Laufe der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche weitere Gebäude für Zwecke der TU Wien angekauft oder angemietet (Standorte Favoritenstraße, Floragasse, Karlsgasse, Argentinierstraße, Operngasse/Treitlstraße u.a.). Mit wenigen Ausnahmen liegen sie alle im näheren Einzugsbereich des Hauptgebäudes am Karlsplatz, der sich inzwischen längst von der „Vorstadt“ in einen zentralen innerstädtischen Standort gewandelt hat. Dessen Qualitäten haben in den wiederholten Diskussionen um eine Absiedelung der gesamten Institution auf einen „Campus“ am Stadtrand seit Ende des 19. Jahrhunderts (der Lainzer Tiergarten wurde ebenso vorgeschlagen wie die „Donau City“ oder das ehemalige Flugfeld Aspern) den Ausschlag für einen Verbleib am gegenwärtigen Standort gegeben. Es war also doch eine zukunftsweisende Wahl, die vor fast 200 Jahren getroffen wurde.
Juliane Mikoletzky, Archiv der TU Wien
"News" aus dem Archiv
Was macht das "Wiener Beugerl" im TU-Archiv? "Privilegierte Backrezepte", öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Prominente Besuche, interessante Events und mehr...
Die Ausstellung „Kauft bei Juden, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster“ im Jüdischen Museum Wien 2017 widmete sich der vergessenen Geschichte der Wiener Kauf- und Kaffeehauskultur. Der Schauspieler August Zirner, Enkel der exzentrischen Besitzerin des Kauf- und Kaffeehauses Zwieback, Ella Zirner-Zwieback, war auf Spurensuche im TU-Archiv.
Auch in der Donaumonarchie gab es legendäre Warenhäuser – vergleichbar mit Harrods oder Printemps. Die Häuser jüdischer Kaufmannsdynastien wie die der Familien Rothberger oder Zirner-Zwieback prägten das Wiener Stadtbild vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Angehörigen dieser Familien wurden jedoch von den Nazis vertrieben oder in der Shoah ermordet. Das Jüdische Museum Wien widmet dieser Epoche nun eine eigene Ausstellung: „Kauft bei Juden“
Keines dieser großen Kaufhäuser – mit Ausnahme des Gerngross – existiert heute noch. Nach dem „Anschluss“ wurden die Unternehmen arisiert, was auch nach dem Zweiten Weltkrieg nur teilweise rückgängig gemacht wurde. „Die Restitution fiel mager aus“, betont Museumsdirektorin Danielle Spera unter Verweis auf die Familie Zirner oder die Familie Rothberger.
Die „Maison Zwieback“ – das „pariserischste“ aller Wiener Kaufhäuser
Die Maison Zwieback galt in den 1910er und 20er-Jahren als das „pariserischste“ aller Wiener Warenhäuser. Ella Zirner-Zwieback, stets von einem Hauch Skandal umweht, brachte in elegantem Rahmen an der Kärntner Straße den letzten modischen Schrei und „Pariser Chic“ nach Wien. „Sie war ihr eigenes Mannequin. Und war eine kühne Geschäftsfrau“, erzählt ihr Enkel, der Schauspieler August Zirner. Diesem Inbegriff von Chic wurde 1922 ein erschreckend visionäres Denkmal gesetzt: Hugo Bettauer sagte in seinem Roman „Die Stadt ohne Juden“ Ella Zirner-Zwiebacks Vertreibung voraus – und das Ende der mondänen Kaufhaus-Kultur. Ella Zirner-Zwieback führte neben dem Warenhaus auch ein Kaffeehaus.
Um 1910 gestaltete der Architekt Friedrich Ohmann die Innenräume und die Eingangszone mit dem Geschäftsportal von Maison Zwieback. Ab dem zweiten Erdgeschoß wurde es mit einem dreiachsigen Eck-Erker ausgestattet. Das Gebäude gliederte sich in Verkaufsräume (Souterrain, Erdgeschoß, erstes und zweites Obergeschoß), Büros, Werkstätten und die Wohnung des Maschinisten in den oberen Geschossen sowie Depots und ein Maschinenhaus im Souterrain. Eine Büste des Firmengründers war an der Haupttreppe angebracht.
Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 an Hitler-Deutschland wurde Zirner jedoch zur Aufgabe der Konzession gezwungen und ihre gesamte Liegenschaft „arisiert“. Sie verließ 1938 Wien und lebte bis zu ihrem Tod in Amerika. Nach dem Krieg klagten Ella Zirner-Zwieback und ihr Sohn Ludwig auf Restitution. 1951 erhielten sie zwar das Geschäft in der Kärntner Straße zurück, nicht jedoch das restliche Eigentum. Das Geschäft verkaufte sie 1957.
August Zirner und Katalin Zsigmondy: Spurensuche im TU-Archiv
Friedrich Ohmann hatte 1877/78 bis 1882/83 u.a. an der damaligen TH Wien studiert und war hier auch als Assistent von Karl König (Lehrkanzel für Baukunst) tätig. Teile seines Nachlasses befinden sich im Universitätsarchiv der TU Wien. Daher besuchte August Zirner gemeinsam mit seiner Frau Katalin Zsigmondy im Zuge der Ausstellung im Jüdischen Museum Wien das Universitätsarchiv der TU Wien, um sich die dort vorhandenen Unterlagen, Korrespondenzen und vor allem hervorragende Fotografien betreffend die Ausstattung der „Maison Zwieback“ anzusehen.
Nicole Schipani, Fundraising and Community Relations @ TU Wien
Ausschnitte der Buchpräsentation im Jüdischen Museum Wien am 15. März 2017 sowie weitere Informationen zum Buch sehen Sie hier, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
