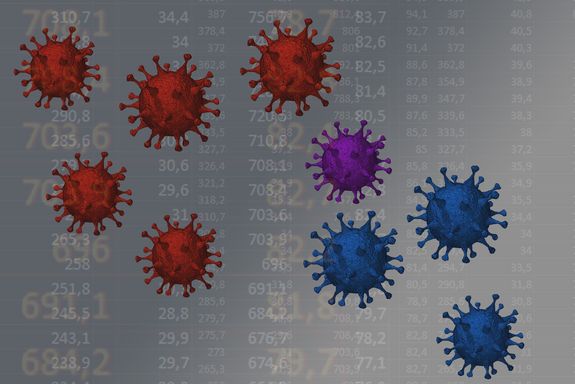Seit Ausbruch der Pandemie analysiert Niki Popper mit seinem Team das Infektionsgeschehen. Modelle werden entwickelt und laufend verfeinert, um die Dynamik der Pandemie besser einschätzen zu können. Auch mit den neuen Viren-Mutationen hat sich Niki Popper bereits beschäftigt.
Wie schätzen Sie die Lage derzeit ein?
Popper: Die neue Mutation hat sich in vielen Regionen Österreichs ausgebreitet. Zuerst haben wir das an den Kläranlagenanalysen gesehen. Daran, dass die Infektionszahlen nicht so rasch gesunken sind wie erhofft, sind aber nicht die neuen Mutationen schuld – sie bestimmen derzeit noch nicht die Dynamik der Pandemie insgesamt.
Das dürfte sich aber ändern: In den nächsten Tagen und Wochen werden die neuen Varianten – präzise gesagt: Viren mit der Mutation S-N501Y, wie etwa die Variante B.1.1.7 – aller Voraussicht nach die in Österreich dominierende Variante werden und auch die weitere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie maßgeblich bestimmen. Mittlerweile wissen wir durch Nachtests positiv getesteter Personen, dass beispielsweise in Wien und im Burgendland die regionale Verteilung dieser Mutationen hoch ist. Dort müssen wir jetzt genau hinschauen.
Das heißt, ein Steigen der Infektionszahlen ist unvermeidlich?
Popper: Ich halte wenig von Prognosen, die über die nächsten Tage hinausgehen. Die Lage ist epidemiologisch schwierig. Die aktuellen Prävalenzen und der erwartbare Einfluss verschiedener Mutationen sind zusammen gesehen ein Zeichen für bevorstehendes Wachstum. Aber den Eindruck zu vermitteln, dass man dagegen ohnehin nichts tun könnte, das wäre völlig falsch.
Wie sieht der Zugang Ihrer Forschungsgruppe nun aus?
Popper: Wir versuchen, uns mit unserem Netzwerk-Modell ein Bild der Gesamtsituation zu machen. Dabei gibt es viele Aspekte, die man berücksichtigen muss: Natürlich die Mutationen, aber auch die Dunkelziffer, die Test- und Isolierungsstrategie, die Saisonalität und der Fortschritt beim Impfen. Laufend erstellen wir Studien zu verschiedenen Teilaspekten und fragen: Was soll man jetzt tun?
Gemeinsam mit dem Prognosekonsortium arbeiten wir auch daran, für eine bessere Information der Öffentlichkeit zu sorgen – denn leider werden auch viele irreführende Daten veröffentlicht. Nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil das bei der aktuellen Fülle an Informationen sehr leicht passiert. Wenn nun etwa von einem „sprunghaften Anstieg bei der britischen Variante“ gesprochen wird, weil die Zahl der Fälle von 1 auf 84 gestiegen ist, dann verunsichert das viele Menschen. Ja, natürlich zeigt uns das, dass die Mutation bei uns angekommen ist, aber der Anstieg lässt sich höchstwahrscheinlich einfach mit dem Zeitverzug beim Messen erklären.
Wie verlässlich sind derzeit die Daten dazu?
Popper: Bezüglich der Mutationen haben wir noch immer wenige belastbare Zahlen. Behörden und Wissenschaft arbeiten jetzt gemeinsam daran, Daten zu erheben und aufzubereiten. Die Bundesländer wurden gebeten, Screenings zu machen, also positive Tests auf Mutationen nachzutesten. Dabei geht es nicht um ein vollständiges Sequenzieren – das wäre genauer, würde aber länger dauern. Im Screening geht es darum, mittels PCR-Tests gezielt nach den bereits bekannten Mutationen zu suchen – das ist deutlich weniger aufwändig. Wichtig ist allerdings, sich nicht bloß auf eine Mutation zu fokussieren. Es wird noch viele weitere Mutationen geben – die meisten werden allerdings die Eigenschaften des Virus nicht verändern.
Man hat die mutierten Viren im Abwasser gefunden – ist das eine sinnvolle Nachweismethode?
Popper: Ja, das ist sehr sinnvoll. Wir koordinieren uns hier unter anderem mit Professor Norbert Kreuzinger, der an der TU Wien Abwasserforschung betreibt. Dadurch kann man sehr frühzeitig abschätzen, ob und wo sich bestimmte Mutationen ausbreiten. Es ist aber nur eine der Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden: Wir arbeiten derzeit auch mit der Meduni Wien zusammen. Dort werden im Sentinella System Proben aus ganz Österreich untersucht, die von symptomatischen Patientinnen und Patienten stammen. So kann man feststellen, wer Influenza und wer tatsächlich COVID-19 hat, und um welche Variante des Virus es sich handelt.
Am wichtigsten sind aber Tests von Erkrankten und Screenings in der Bevölkerung. Entscheidend ist die Gesamtsicht: All diese Daten sind Mosaiksteine, die man mit Hilfe von Datenanalyse und Modellierung zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammenfügen muss. Genau daran arbeiten wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich.
Wie schätzen Sie die jetzt gesetzten Maßnahmenlockerungen ein – gibt es Argumente warum die Zahlen jetzt nicht steigen sollen?
Popper: Das ist eine berechtigte und schwierige Frage. Rein epidemiologisch ist die Situation alles andere als erfreulich. Aber aus anderen Forschungsbereichen wie Kinderpsychologie, Sozialwissenschaften und Ökonomie wissen wir, dass man nicht nur epidemiologische Argumente berücksichtigen darf.
Entscheidend für unsere Modelle ist: Die aktuellen Maßnahmen wirken nicht mehr gut, viele Menschen halten sich nicht mehr daran. Die Maßnahmen bringen also immer weniger Nutzen und kosten die Gesellschaft immer mehr. Wir können aus Modellsicht nur eine Option herausheben: Testen, tracen und isolieren und Screenings durchführen. Darauf kommt es an.
Wird das ausreichend umgesetzt?
Popper: Leider habe ich den Eindruck, dass das noch immer nicht bei allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in allen Bundesländern angekommen ist. Wichtig wäre auch, die Tests zu den Menschen zu bringen. Niemand wird zum Friseur ums Eck gehen, wenn man vorher 20 Kilometer weit zum Testen fahren muss. Wir müssen dafür sorgen, dass die Tests ausreichend schnell durchgeführt werden und bei Bedarf wiederholt werden können. Die Tests sind niemals perfekt, aber sie sind das entscheidende Mittel für die Eindämmung der Pandemie. Bei den infektiöseren Mutationen ist das sogar noch wichtiger als bisher – denn nun werden durch Testen, Tracen und Isolieren noch mehr Neuinfektionen verhindert als bisher.
Manche Leute sind verunsichert und meinen, die Wissenschaft sei ja völlig uneinig über die nötigen Maßnahmen.
Popper: Ich kann verstehen, dass dieser Eindruck entstehen kann, aber das stimmt nicht. Bei den wichtigsten Fragen haben wir Konsens. So ist etwa auch gerade ein Artikel im Fachjournal „Lancet“ erschienen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, der das gut zusammenfasst: Wir müssen dafür sorgen, die Fallzahlen niedrig zu halten, indem wir die Ausbreitung genau beobachten, indem wir testen, tracen und isolieren und indem wir Reisen einschränken. Gleichzeitig müssen wir schneller impfen.
Welche Rolle spielt die Impfung derzeit?
Popper: Momentan haben die Impfungen noch keine Auswirkung auf die Ausbreitung, und das wird in nächster Zeit noch so bleiben. Einerseits wissen wir noch nicht, ob die Impfung überhaupt dazu führt, dass die Krankheit langsamer weitergegeben wird – auch wenn das mittlerweile doch sehr wahrscheinlich erscheint. Und andererseits braucht man nun einmal einen hohen Anteil geimpfter Personen, um eine spürbare Auswirkung auf die Zahl der Neuinfektionen zu sehen. Aber die gute Nachricht ist: Wenn wir ältere und vulnerable Bevölkerungsgruppen impfen, sollten wir rasch einen Rückgang bei Hospitalisierung und Todeszahlen sehen.
Interview: Florian Aigner