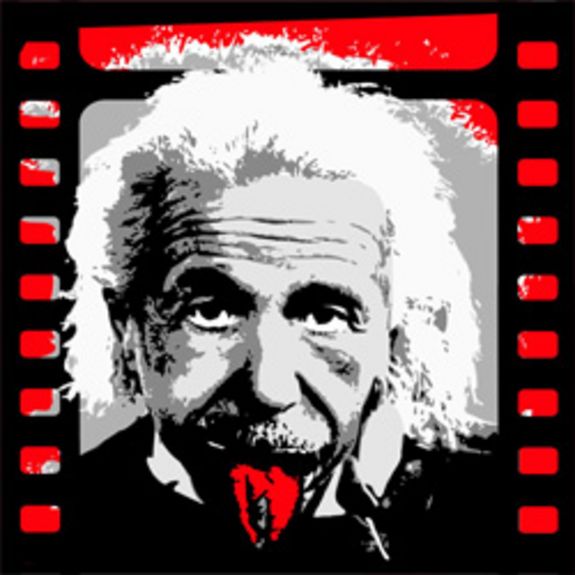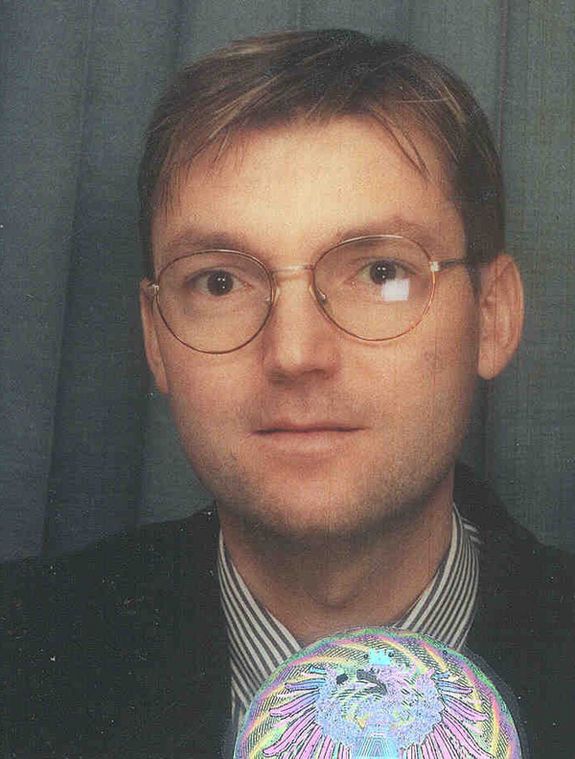Die derzeitige weltweite Energieversorgung entspricht noch bei weitem nicht dem Kriterium der Nachhaltigkeit, da sie zum überwiegenden Teil auf fossilen Energieträgern (Erdöl, Kohle und Erdgas) beruht. Ohne rechtzeitigem Umstieg auf erneuerbare Energieträger wird eine dauerhafte Veränderung des Erdklimas eintreten. In vielen Ländern wird außerdem auf die risikoreiche Kernenergie zurückgegriffen. Dabei nimmt man die Belastung der Umwelt mit über Jahrtausende radioaktiv strahlendem Müll für ein paar Jahrzehnte der Energiegewinnung in Kauf. Eine sinnvolle Nutzung von Holz als Primärenergieträger brächte ökologische und ökonomische Vorteile:
- Die Verbrennung von Holz ist CO2-neutral: Bei der Verbrennung von Holz wird nur jene Menge CO2 freigesetzt, die bei der Photosynthese aus dem CO2 der Luft gebunden wurde.
- Holz ist ein Rohstoff, der - da "erneuerbar" - praktisch unerschöpflich ist: In Österreich beträgt der laufende Zuwachs im Ertragswald 28 Mio. Festmeter jährlich. Die Nutzung beläuft sich hingegen auf lediglich 20 Mio. Festmeter.
- Holz steht im Gegensatz zu fossilen Energieträgern in Österreich in ausreichendem Maß zur Verfügung: Die Verwendung von Holz als Energieträger vermindert die Abhängigkeit von Energieimporten.
Das <link http: info.tuwien.ac.at histu inst _blank>Institut für Thermische Turbomaschinen und Energieanlagen hat im Rahmen des EU-Projektes [<link http: www.tuwien.ac.at forschung nachrichten>01] eine Anlage zur umweltschonenden Stromerzeugung aus Holzstaub entwickelt:

schematische Darstellung der Anlage
Fördersystem und Brennkammern
Ein am Institut entwickeltes Brennstoffördersystem (Abb. 1) garantiert eine gleichmäßige Holzförderung in die druckaufgeladene zweistufige Brennkammer (Abb. 2). In der ersten Stufe (Zyklonkammer) erfolgt unter Sauerstoffmangel die teilweise Verbrennung des eingebrachten Holzstaubes. In der zweiten Stufe (sekundäre Nachbrennkammer) werden die in der Primärkammer gebildeten Verbrennungszwischenprodukte nachverbrannt. Durch die zweistufige Verbrennung können einerseits die Verbrennungstemperaturen niedrig gehalten werden (unter 1200 Grad) und andererseits die Umweltbelastung reduziert werden: Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen können großteil verhindert und Stickoxidemissionen erheblich reduziert werden.
Axialzyklon und Turbine
Das heiße Gas aus der Brennkammer wird durch einen Zyklon [<link http: www.tuwien.ac.at forschung nachrichten>02] (Abb. 3) geleitet, um die mit dem Gasstrom mitgeführten Feststoffpartikel abzuscheiden. Asche und Verunreinigungen verschmutzen und beschädigen die Turbinenteile. Der Zyklon, eine Neuentwicklung des Instituts, wird axial durchströmt und ist aufgrund seiner kompakten Bauform speziell für die Heißgasentstaubung geeignet. Mit dem heißen druckaufgeladenen Gas wird eine Standard-Turbine (Abb. 4) betrieben. Nach ersten erfolgreichen Testläufen Anfang März werden jetzt Versuche mit unterschiedlichen Holz(staub)sorten durchgeführt.
Einsatz in der Holzverarbeitung
Die Chancen stehen gut, dass es holzverarbeitenden Betrieben künftig möglich ist, mit Hilfe dieser Anlage den Eigenbedarf an Strom und Wärme zu decken. Die Betrieb könnten so die in der Holzverarbeitung anfallenden Holzabfälle nutzbringend verwerten.